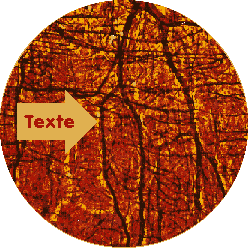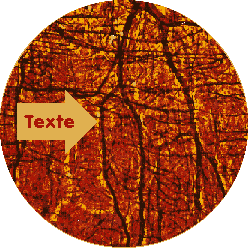Die geostrategische Rolle Deutschlands hat sich durch
den Kosovo-Krieg verändert. Aber wie?
Im März 1999 demonstrierte Deutschland seine wieder- gewonnene nationale
Souveränität. Politik, Militär und Bevölkerung erwiesen sich als
kriegstauglich.
Ob man den Weg zu diesem Ziel als rasend schnell zurückgelegt, oder als
besonnen und umsichtig beschreibt, hängt wohl vom apologetischen oder
kritischen Standpunkt des Betrachters ab. Planerische Zielstrebigkeit ist an
drei Komponenten, die diese historische Zäsur so reibungslos ermöglichten,
zu bebildern.
Erstens wäre da das - manchmal nur symbolische - Mitmachen, wie es
etwa in der Entsendung deutscher Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer
während des Iran-Irak-Kriegs zelebriert wurde, oder in der Verlegung einer
Jagdbomberstaffel in die Türkei, um dort einen - nie geplanten - irakischen
Angriff auf den NATO-Partner abwehren zu helfen. Auch
Bundeswehrangehörige auf Rücksitzen von AWACS-Aufklärern hatten
militärisch kein großes Gewicht. Selbst bei den Einsätzen in Kambodscha
(91-93), in Somalia (93-94) und Ruanda (94) war der von General Bernhard
betonte Aspekt, »wieder zur Familie« zu gehören, gewichtiger als jede
reale Effizienz. Für Verteidigungsminister Rühes Maxime, »Normalität Schritt
für Schritt durchzusetzen«, wurde manchmal berufsfremd geschaufelt und
gehämmert, statt gebombt und geschossen. Von anderer Dimension war
der 1995 gefasste Beschluss der Beteiligung an der schwer bewaffneten
IFOR-Truppe und 1997 an der Nachfolgemission SFOR. Hier wurde die letzte
aus deutscher Historie abgeleitete Restriktion, »dass wir aus Gründen
geschichtlicher Erfahrung keine deutschen Soldaten, also Bodentruppen, in
das frühere Jugoslawien« schicken (Kohl, 19. Dezember 94) beseitigt. Im
Rahmen dieses Einsatzes wurde endlich auch geschossen, auf dem
Flughafen von Tirana, eine Evakuierung sichernd; großartig, tapfer, präzise
- wie alle Medien berichteten.
Im gleichen Zeitraum wurden materielle, militärdoktrinäre und rechtliche
Veränderungen vollzogen, an denen abzulesen war, dass die Ambitionen
das schon Praktizierte weit überschritten. Beispielhaft zu nennen wären
hier die von Verteidigungs- minister Stoltenberg eingeführten »modifizierten
Doktrin« (92), die die Bundeswehr als »politisches Instrument zur
Sicherheitsvorsorge« beschrieb und, weil Vorsorge ein weltweites Projekt
ist, logisch zur Aufteilung der Armee in »Hauptverteidigungskräfte und
Krisenreaktionskräfte« führte. Die Debatte mündete in den neuen
»Verteidigungspolitischen Richtlinien«, die das alte Wort vom
Bündnisinteresse durch das »nationale Interesse« ersetze, welches durch
die »Aufrechterhaltung des freien Welthandels und den ungehinderten
Zugang zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt« gekennzeichnet sei, also
demonstrativ unrealistisch, utopisch (»ungehindert«) ist.
Das Bundesverfassungsgericht goss dann, im Sommer 1994, die imperialen
Notwendigkeiten in ein Urteil und erklärte weltweite
Bundeswehrkampfeinsätze im Rahmen der UNO, auch unter Federführung
von NATO und WEU, für verfassungskonform.
Zweitens avancierte Jugoslawien zum bevorzugten Objekt dämonisierender
Propaganda und Experimentierfeld deutscher Übungen, auch im Alleingang
außenpolitische Vorstöße zu wagen. Die Transformation von einem eher
sympathischen Staat, der sich so bewundernswert tapfer unabhängig von
Moskau hält, seinen Untertanen Reisefreiheit gewährt und eine nette
Olympiade zu veranstalten vermag, in ein Völkergefängnis mit serbischen
Aufsichtspersonal, war eine Demonstration der Wirkungsmacht
ideologischer Apparate und des Funktionierens manipulativer Techniken.
Genschers »mit jedem Schuss rückt die Unabhängigkeit näher« und die
Anerkennung Sloweniens und Kroatiens ohne Abstimmung mit den
europäischen Partnern waren schon die Verwirklichung dessen, was einige
Jahre zuvor, als noch die Unverletzlichkeit der Grenzen beschworen wurde,
als Spleen eines rückwärtsgewandten »FAZ«-Herausgebers gegolten hatte.
Man wusste sich in Kroatien gefeiert, hatte erstklassige Kenntnis der
»Volksdruckverhältnisse« bewiesen, musste aber im weiteren Verlauf
schlucken, dass die USA der bosnischen und kroatischen Armee die
materiellen Mittel zur Verfügung stellte, mit denen Jugoslawien Territorien
entrissen oder die Serben aus der Krajina vertrieben wurden.
So diktierte die militärische Hauptmacht den Vertrag von Dayton, der
manchem deutschen Politiker zu viel Arrangement mit den Serben zu
enthalten schien, was in der Aufforderung mündete - damit nicht Schluss
sei mit Zerstückelung - nun endlich den »Scheinwerfer auf das Kosovo zu
richten« (Kinkel). Hier hatte sein Geheimdienst eine UCK (mit-)aufgebaut,
die in Deutschland schon Befreiungs- bewegung hieß, als man sie in anderen
Zentren noch Terroristen nannte. Im Sommer 1998 beklagte die deutsche
Außenpolitik, manch NATO-Partner ließe es an Ernsthaftigkeit für ein
»militärisches Vorgehen im Kosovo« missen und stellte sich stramm gegen
Überlegungen, die Waffenzufuhr Richtung UCK durch eine Kontrolle der
albanischen Grenze zu minimieren.
Drittens war, der konkreten Einstimmung auf einen Krieg meines Erachtens
gleichgewichtig, ein allgemeines Klima inszeniert, das Gerede der
erwachsenen, der selbst- bewussten, der ihre gewachsenen Verantwortung
in der Welt gerecht werdenden Nation. Dem Partner in Leadership.
So wurde zum Gemeinplatz, dass die zurückliegenden, berechenbaren
Zeiten zwar Wirtschaftskraft und Wirtschaftsmacht gemehrt hätten, aber
irgendwie doch auch fad gewesen seien. Selbst über Helmut Kohl, dessen
Außenpolitik doch von Schröder und Fischer Kontinuität versprochen
wurde, bekam manch ungerechtes Urteil über sich verhängt. Er sei,
schreibt 1999 der »Spiegel« im Rückblick auf Deutschlands Geschichte
nach 45, nie mehr gewesen als »der Biedermann in einer idyllischen
Republik«, ein echter Langweiler, »verlässlich und unbedrohlich nach
außen, beweglich und banal nach innen«, der »Repräsentant für die
drückebergerische Maskerade als prosperierende Provinz«. Das ist, wie
gesagt, ungerecht, verrät aber die Lust in bestimmten Kreisen, es möge
richtig »loooos«gehen.
Das ging's dann auch.
Die Werte von Schröder, Scharping, Fischer stiegen auf der
Beliebtheitsskala, die Propaganda erklomm höchste Gipfel. Sie führte
allerdings nicht zu einem fanatisierten Mob. Die Grundstimmung in der
breiten Bevölkerung, wie man sie als Anti-Kriegs-Demonstrant in
Fußgängerzonen trifft, war erstaunlich ignorant und gelassen. Kein Gepöbel
wie bei anderen Anlässen, zum Beispiel antirassistischen Manifestationen,
üblich. Das Phänomen hat sicher damit zu tun, dass alle Parteien integere
Bedenkenträger abstellten: Wimmer, Voscherau, Schmidt, Dregger.
Zweitens hatten die Grünen sich verständigt, einander höchstmoralische
Gründe für jede Position zu bescheinigen, und selbst Generäle hatten den
grünen Debatten gesellschaftliche Bedeutung attestiert, freilich
hinzufügend, dass diese ohne Einfluss auf die reale Kriegsführung seien.
Trotz einiger harscher Worte Richtung Gysi, hatten weder die einen noch
die anderen Sozial- demokraten ein Interesse, das Maß
demokratisch-pluraler Meinungsverschiedenheiten zu gefährden. Man stritt
wie die Völkerrechtsexperten stritten, den kollegialen Respekt nie
verlierend.
Außerdem - kein unwichtiger Faktor für Stimmungen in Fußgängerzonen -
waren die Nazis mehrheitlich gegen den Krieg, der ihnen kein authentisch
deutscher war. So spürte der autoritäre Charakter die geschlossene
Unbedingtheit, die ihm Sicherheit und Ansporn bietet, nicht.
Die ignorante Gelassenheit hat einen zweiten Grund. Was vor dem Golfkrieg
noch unbekannt war, wurde durch ihn offenbar. Kriege dieser
Größenordnung werden ohne relevante Auswirkungen auf das Heimatland
des Aggressors geführt.
Im Golfkrieg wurden 190.000 irakische Soldaten getötet, die USA verloren
126 GIs. Weder im Krieg gegen Jugoslawien noch während der
Besatzungszeit starb auch nur ein deutscher Soldat durch Feindeinwirkung.
Die unvermeidlichen Soldatenmütter haben grundlos demonstriert. Die
Frage nach Gesundheitsschäden deutscher Soldaten durch Uranmunition
bebildert nur die Gleichgültigkeit gegenüber realen Opfern, auch den
albanischen übrigens, die ihren vorübergehenden Wert als Ware leidender
Mensch längst eingebüßt haben.
Die Gelassenheit gegenüber einem Angriffskrieg, der das Betätigungsfeld
einer Berufsgruppe - der Soldaten - ist, findet ihre Entsprechung in der
Resistenz gegen alle Enthüllungen von Propagandalügen, die den Krieg
legitimierten.
Oft wird der Bürger bei solchen Vorgängen nicht betrogen. Er nimmt nur ein
aus anderen Zusammenhängen bekanntes Gewohnheitsrecht in Anspruch,
dass der Staat seine inhumansten Maßnahmen als Wohltaten kostümiert,
auch um den zustimmenden Untertanen die Ausreden zu servieren. Man
hilft den armen Ländern beim Wirtschaftsaufschwung, indem man keine
Flüchtlinge in Deutschland duldet; zu viel Entwicklungshilfe entmündigt;
durch Arbeitsdienst erlangt der Sozialschmarotzer seine Würde zurück; ein
Massaker in Racak war uns unerträglich, ein Hufeisenplan zwang uns zum
Einschreiten. Man zwinkert einander komplizenhaft zu. Das gilt auch für das
anspruchsvollere Segment, welches von Habermas und Diedrichsen,
Goldhagen, Kraushaar und Heer Bedienung verlangte.
Verlässt man den dort angebotenen Himmel der Ideologien, können einige
elementare Schlüsse gezogen werden: Die schon beschriebene
»Unverwundbarkeit des Aggressors« - stets ist sie auch Dementi der vor
dem Krieg behaupteten militärischen Macht des Feindes - hat heute noch
eine Bedingung. Voraussetzung ist, dass die USA einen Teil ihrer
Militärmaschinen einbringt, materiell die Führungsposition im Krieg besetzt.
Diese Tatsache produziert jede Menge Handlungsbedarf der subalternen
Partner. Dazu später. Für Kriege dieser Art bedarf es also gegenwärtig
einer Interessenidentität, oder zumindest weitreichender Überschneidungen
der Interessen.
Die allgemeine Botschaft des Kriegs, dass es die NATO gibt, die im
Bedarfsfall Staatsschutzgarantien zu nehmen und zu geben vermag, dass
also zum Beispiel von Russland als Bündnispartner oder Patron weniger zu
erwarten ist, wurde ergänzt durch die ebenso demonstrative wie
absichtsvolle Bombardierung der chinesischen Botschaft. Den gleichen
Zweck verfolgt die Missachtung der UNO, des Völkerrechts, ein Sitz im
Sicherheitsrat war im Konkreten wertlos.
Wo nicht moralisiert wurde, wo sogar die Sorge bestand, zu viel Moral
könne sich als zukünftiges Hemmnis bei der Wahrnehmung materieller
Interessen erweisen, wurden die Zwecke keineswegs geheim gehalten.
Zum Beispiel in der »FAZ«: »Wer im Namen der internationalen Stabilität die
Hegemonie in der Welt beansprucht, muss irgendwann damit beginnen, sie
zu demonstrieren - mit oder ohne Rücksicht auf das Völkerrecht.« Es gehe
immerhin um die geoökonomische Verknüpfung der westlichen
Schwarzmeerküste (...) für den Transport russischer, kaukasischer oder
auch zentral- asiatischer Energieträger.«
Auch Clinton erläuterte den wichtigsten Chefredakteuren seines Landes
den weit über Jugoslawien hinausweisenden Anspruch, eine Region
gewaltigen Ausmaßes zu ordnen. Jugoslawien sei »kein Einzelfall« sondern
Mosaikstein. »Ein Großteil der früheren SU steht vor ähnlichen
Heraus- forderungen, darunter Südrussland, die Kaukasusnationen (...) sowie
die neuen Nationen Zentralasiens.« Nicht zu übersehen war bereits
während des Kriegs, dass Deutschland eine weniger scharfe Frontstellung
gegen Russland anstrebt. Einige mit den USA geteilte Interessen, zu denen
zum Beispiel die Osterweiterung der NATO gehört, werden konterkariert von
deutscher Ambition, Russland als Energielieferanten zu stabilisieren, also
weniger krass von Quellen abzuschneiden und als Transportkorridor zu
eliminieren, wie es amerikanische Zielsetzung ist.
Bei mittelprächtiger Ernsthaftigkeit hätte der Krieg gegen Jugoslawien, das
in seiner Folge entstehende Protektorat und die geopolitischen
Weiterungen, die Clinton von »kein Einzelfall« sprechen ließen, zur
Beerdigung der modischen »Theorie« der neunziger Jahre führen müssen.
Sie bestand in der Bescheidwisserei, dass alle Staaten einen enormen
Bedeutungsverlust erlitten hätten, ihren Bestrebungen also nur noch
geringe Aufmerksamkeit gebühre. »Es ist richtig, dass es weitgehend
irrelevant ist, ob und wie die BRD jetzt Weltmacht geworden ist, weil sie in
einem Kontext agiert, der von den internationalen Finanzmärkten und von
200 Weltkonzernen bestimmt wird.« Der Gedanke, dass die Weltkonzerne
eines ihren Geschäften bahnbrechenden Staats bedürfen, der dabei eben
auch anders national fundierten Konkurrenten den Zugang versperrt, war
ebenso obsolet, wie die einst bekannte Wahrheit, nach der Finanzmärkte
auf die in diesem Prozess sich als Sieger und Besiegte erweisende
reagieren.
Aus falscher Prämisse folgt stets ein noch falscherer Schluss, der sich
damals so präsentierte: »Für die Finanzmärkte wird (...) eine Politik der
langfristigen globalen ,Friedenssicherung’ vordringlich, um internationale
Weiterungen der (...) ,Ethnisierung des Sozialen’ zu verhindern.«
Man könnte den Mantel des Schweigens über ältere Dispute legen,
erwiesen sich die »Theorien« nicht als von aller Wirklichkeit
unbeeindruckbar, wie man im »Schwarzbuch Kapitalismus« nachlesen kann,
wo die »so genannte Außenpolitik keine hohen Wellen mehr« schlägt, weil
»das Ende des alten Imperialismus« gekommen ist und deshalb »in der
entkoppelten Sphäre der Nicht-Orte territoriale Herrschaft sinnlos (wird), in
welcher Form auch immer«.
Und in Seattle oder Prag beklagen die Demonstranten die »Schwäche der
Staaten« und flennen, dass den »Nationalparlamenten die Macht
entrissen« sei.
Was im Jugoslawien-Krieg vielen als erträgliche Pluralität unter linken
Kriegsgegnern erschien, barg Antagonismen, die heute, man betrachte die
unversöhnlichen Positionen zum Nahost-Konflikt, offenbar sind.
Die PDS-»Zeitung gegen den Krieg« warf der politischen Chefetage vor,
»sie lassen sich zu Vollziehern amerikanischer Außenpolitik machen«; die
»Junge Welt« ergänzte, »Satellitenstaaten, die so genannten
NATO-Verbündeten, werden in bester Gangstermanier zu Komplizen
gemacht«, und Tage später waren die Komplizen schon keine mehr, denn
»auch die Deutschen sind NATO-Opfer«. Da war viel Schulterschluss mit
CDU-Wimmer und Augstein - und Walser eignete sich als Kronzeuge erneut.
Wer, wie zum Beispiel die »Junge Welt«, heute EU und Deutschland als
Gebilde sehen, die von den »USA erst noch in die Unabhängigkeit
entlassen« werden müssten, kommt zwangsläufig bei
zwischenimperialistischen Konflikten zur Parteinahme. Übrigens mit
Methoden, die denen der Grünen nicht unähnlich sind, wie man an der
Kampagne zur Beendigung der Irak-Sanktionen erkennt. Purer Humanismus
wird jenen bescheinigt, die der amerikanischen Ordnungspolitik mit eigenem
Kalkül entgegentreten. Sehnsüchte erfüllten sich, käme es zur
Stationierung internationaler Truppen in palästinensischen Gebieten. Im
Namen der Völkergemeinschaft die Juden in die Schranken verweisen, das
verdiente den Namen Friedensmission.
Ein Teil der antideutschen Linken hat sich nicht darauf beschränkt, den
Nationalismus der patriotischen Strömung zu kritisieren und Deutschlands
aktiven Anteil an der Zerschlagung Jugoslawiens zu betonen, sondern
Deutschland Potenzen angedichtet, die es nicht besitzt. Thomas Becker
sah in der Jungle World die USA »in die Falle getappt«, von Deutschland
verführt zu einem Krieg, den sie »nicht nur nicht gewollt hatten« und den
sie »nicht gewinnen können«. Jürgen Elsässer entdeckte die »Falle von
Rambouillet«, in die die tapsige Diplomatie der Amis gelockt worden sei, und
Hermann Gremliza erblickte »die notarielle Beglaubigung, dass nach der
Sowjetunion die USA der zweite Verlierer der weltpolitischen Wende
geworden sind«. Wer so schreibt, hat sich von jeder Analyse ökonomischer
Kräfteverhältnisse und militärischer Schlagkraft verabschiedet. Oft ist auch
Hoffnung im Spiel, andere Nationen könnten deutsche Vorgehensweisen
»aus historischen Gründen«, zum Beispiel der Entstehungsgeschichte ihres
Nationalstaates, nicht kopieren, also »nie« das Ziel verfolgen, »bestehende
Staaten zu zerstückeln und dem ,Sezessions- recht’ nationaler Minderheiten
zum Durchbruch zu verhelfen« (M. Künzel). So viel Tragkraft besitzt
Geschichte nicht, was kein Argument ist, deutsche Kontinuitäten zu
ignorieren.
Eine Tiefpunkt »antideutscher« Regression bot die »Bahamas«. Kämpferisch
wurde hier verfochten, dass aus einer für die Kapitalzwecke »definitiv
unbrauchbar gewordenen Welt« jedes Subjekt verschwunden ist, das »kühl
Vor- und Nachteile abwägt«. Jetzt pissen sich alle irgendwie selbst ans
Bein, denn (den Bombenopfern in Belgrad zum Trost) »der Krieg in
Jugoslawien ist einer der Aggressoren gegen sich selbst um nichts«. Da
kann man nur noch »Wahnsinn« murmeln, wenn man zum Beispiel bedenkt,
»dass absolut niemand nach Bahn vordringen will, aber es durchaus möglich
ist, dass plötzlich alle so tun, als ob sie es wollen, nur um damit zu zeigen,
dass sie es könnten«. In Bahn, am Kaspischen Meer, eigentlich im
gesamten Nahen Osten ist nichts zu holen, denn nur »der Fetisch des
Dinghaften, lässt übers Erdöl phantasieren, dessen Preis auf dem
Weltmarkt den von Limonade schon längst unterboten hat«.
So verschwindet die Bedeutung des Erdöls für die kapitalistische
Wirtschaft, also auch die Bedeutung, wer es ausbeutet, Transportkorridore
sichert, zu diesem Zweck Staaten zerschlägt oder in Schurken und
Sicherheitsanker unterteilt - man könnte das alles auch für Limonade
veranstalten. Die Entfernung von jeder Materialität ist der Produzent
spektakulärer Thesen. Wenn Öl Limonade ist, ist eben die PLO die UCK.
Manchmal ist die Verzweiflung über den Irrsinn der Welt so groß, dass man
aufräumen möchte, zum Beispiel mit Palästinensern, deren Wahn man
genau erforscht hat und deshalb weiß, wie leicht ihnen das Sterben fällt.
Auch Linke, die sich nicht gänzlich vom Materialismus verabschiedet haben,
neigen dazu, aus tagespolitischen Erscheinungen viel zu weitreichende
Schlüsse, manchmal ganze »Welterklärungsmuster«, zu ziehen. Erinnert sei
zum Beispiel an das Jahr 1997, als Deutschland auf den EU-Gipfeln in Dublin
und Amsterdam einige Konzessionen machen musste. Was Kompromisse
einer umsichtig ihre Vormachtstellung erweiternden Macht waren, wurde zu
»Schlappen (...), die das deutsche Finanzkapital einstecken musste«
stilisiert, und »das macht das ganze Projekt (der Einheitswährung) für Linke
sympathisch«. Dem Euro wurde angedichtet, er beschere »den Deutschen
klassen- übergreifend (!) Einkommensverluste«, und in seiner Befürwortung
beweise man, dass »das internationale Proletariat die Referenzgröße linker
Politik ist« (Jürgen Elsässer). Der Unfug hat sich dann verflüchtigt.
Auch eine europäische Militärmacht, die den Euro als Grundlage benötigt,
vollzieht sich als konfliktueller Prozess, und es ist kaum vorherzusagen,
wann sich die »Europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität« (ESVi)
faktisch realisiert. Man denke etwa an die sehr weitreichende Erklärung der
Regierungschefs Frankreichs und Großbritanniens in St. Malo (98) und die
Ernüchterung, die sich darin ausdrückt, dass drei Jahre später
Großbritannien den Irak bombardiert - und Frankreich sich entrüstet zeigt.
Herr Solana, der hohe Vertreter für die gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik der EU, kennt mehrere solcher »Probleme«. Sie heben die
Tendenz nicht auf. Was Daimler-Chef Schrempp, die Rennfahrt-Allianz
vorstellend, als »Sternstunde« bezeichnete, »wir wollen die Position zwei
angreifen, dann die Nummer eins und könnten am Ende die Sieger sein«,
wird auf vielen Gebieten versucht. Noch geht es um Aufholen, nicht
Überholen, wenn es um EU-Verabredungen über strategische Aufklärung,
strategischen Lufttransport, Informations- und Kommuni- kationstechnik,
zielsuchende Munition, Abstandswaffen und Marschflugkörper geht. Halt all
die Sachen, mit denen die Amerikaner vor zwei Jahren ihre Überlegenheit
demon- strierten, und die man besitzen muss, wenn die Euro-Eingreiftruppe
von 80.000 Soldaten wirklich weltweit effektiv sein soll.
So zahlreich die Übungen sind, »amerikanische Bedenken zu zerstreuen«,
so sicher ist man in Washington, eine vollendete ESVi sei ein Instrument,
welches »mit der Zeit mit der NATO konkurrieren könnte« (Außenminister
Talbott) und akzeptiert darum »nur eine der NATO klar untergeordnete
europäische Komponente«.
Diese Unterordnung plausibel zu machen, fahren die Vereinigten Staaten
einiges auf. Schon die Erhöhung des amerikanischen Militärhaushalts um
deutlich über 100 Milliarden Dollar in den nächsten Jahren, übertrifft alle
gegenwärtigen europäischen Dimensionen.
Das amerikanische Raketen-Abwehr-System (NMD) in Kombination mit den
regionalen Abwehrsystemen (TMD) soll die Ausschaltung (oder Minimierung)
des Risikos bewirken, im Kriegsfall von feindlichen Raketen nachhaltig
geschädigt zu werden. So kann jeder kleinere Staat nur beweisen, dass er
kein Schurke ist, durch Verzicht auf hochkalibrige Waffen, es sei denn vom
Westen gelieferte. Die amerikanische Drohung ergeht keineswegs nur an
die Schurken, sondern auch an jene größeren Mächte, die mit dem Bösen
bandeln, also an Russland und China. Sollte es technisch gelingen, die USA
weitgehend gegen russische und chinesische Atomwaffen zu immunisieren,
wäre der Einsatz (»taktischer«) Atomwaffen für Amerika wieder reale
Option. Die auf früherem Waffenvergleich basierende Notwendigkeit, einen
ABM-Vertrag abzuschließen, also auf flächendeckende nationale
Raketenabwehr zu verzichten und den »vernichtenden Gegenschlag« zu
kalkukieren, wäre hinfällig. Nicht im ersten Zug, aber perspektivisch.
Russlands Möglichkeit, der eigenen Entwertung mit radikaler Aufrüstung
Paroli zu bieten, sind ökonomisch kaum realisierbar. So sucht man
Verbündete in China und potente Waffenkäufer zum Beispiel im Iran,
beklagt mangelnde Vertragstreue der Amerikaner, macht der EU Avancen,
billigt aber in Einzelfällen den USA die Definitionsmacht zu, wer Schurke ist.
China, gewiss ökonomisch deutlich potenter und oft schon als der
herausragende Feind der Zukunft besprochen, verfügt bisher noch über ein
vergleichsweise kleines Druckpotenzial gegen die Vereinigten Staaten, hat
eine bescheidene Zahl atomar bestückter Interkontinentalraketen und sieht
sich durch das regionale Militärbündnis der USA mit Japan und Südkorea
bedrängt.
Die europäischen Anstrengungen, selbst größeres Gewicht und mehr
Handlungsfreiheit zu erlangen, erhalten allein durch NMD einen gehörigen
Dämpfer. Eine größere Freiheit der USA zur Kriegsführung ist nicht nach
deutschem Geschmack, zumal die Auswirkungen solcher Kriege, verzichtete
Europa auf eine subalterne Teilnahme am Abwehrschirm, hier gravierender
sein könnten als jenseits des Großen Teichs. Da droht halt der »gespaltene
Sicherheitsstandard«. Auch eine Aufwertung atomarer Optionen trifft
Deutschland, dem dieses Gerät noch fehlt, ziemlich hart. Die Klagen des
zurück- liegenden Jahres, die USA verfolgten eigene statt Bündnisinteressen,
sind lustig und sachkundig zugleich. Auf diesem Feld kennt man sich aus.
Und man weiß auch, dass das amerikanische Angebot, sich am Aufbau des
Schutzschildes zu beteiligen, erstens teuer kommt und zweitens in
subalterne Stellung zwingt.
Dennoch: Gemessen an den deutlich ablehnenden Stellungnahmen
vergangener Monate, zeigen sich nun Schröder, der schnell noch eine
Verdienstmöglichkeit deutscher Rüstungsindustrie entdeckte, und Fischer,
dessen Auftreten in Washington einige Parteifreunde so schnell nicht
begriffen, als Realisten. Der »Spiegel« staunte, die »Süddeutsche« war
innerlich zerrissen, und die »FAZ« bescheinigte der Regierung, die
»bescheidenen Einwirkungsmöglichkeiten« endlich zu nutzen, weswegen
ihre »Lernkurve (...) endlich nach oben zeigt«.
Bei allem täglich zu schürendem Gefühl gegen den zukünftigen
Hauptkonkurrenten, die notwendige Portion Kalkül - auch das wurde in
Deutschland seit 1945 gelernt - kommt nicht zu kurz. So gesehen liegen
vor uns zähe Jahre, mit Vorstößen und Rückziehern. Auch Vorstöße gegen
amerikanische Interessen wird es geben, wie sie sich heute etwa in Libyen,
Irak oder Iran vollziehen.
Vielleicht liegen die Schauplätze auch an der »neuen Seidenstraße«
zwischen Adria und China, wo sich das mutige Protegieren konkurrierender
Herrschaftscliquen anböte. Vielleicht beginnt man in Gegenden, die auf der
amerikanischen Ordnungsskala nicht so hoch angesiedelt sind. Wo
Menschen in kriegerischen Auseinandersetzungen wieder Material,
Kanonenfutter zu verkörpern haben, ist nicht seriös prognostizierbar.
Eine gewisse Vor- und Umsicht wird für Deutschland, der
EU-Hegemonialmacht, allerdings nötig sein. Sonst könnte es einer schönen
deutschen Direktinvestition, sagen wir im Iran, auch mal ergehen wie der
chinesischen Botschaft in Belgrad.
Tröstet das?
Thomas Ebermann
in 'Jungle World'