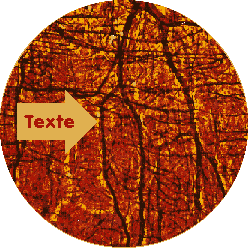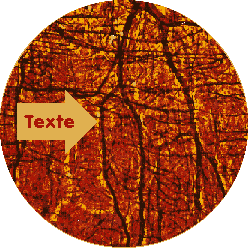Vorbemerkung:
Hier ein interessanter Artikel aus der Schweizer 'WOZ'. Insbesondere zum
Stand der Scheizer Volksabstimmung über das dortige Gen-Moratorium
ist hier in Deutschland kaum je etwas zu erfahren. Am 27. November
werden die SchweizerInnen über dessen Fortbestand entscheiden.
Agro-Gentechnik
Nützlich? Gefährlich? Nachhaltig?
Von Marcel Hänggi (Mitarbeit: Benno Vogel)
Am 27. November kommt die Initiative für ein Gentech-Moratorium in der
Landwirtschaft zur Abstimmung. Aus diesem Anlass: die zwölf wichtigsten
Fragen zur Gentechnik in der Landwirtschaft.
1. Was bietet die Gentechnik der Landwirtschaft heute?
Die kommerziellen Anwendungen der Gentechnik in der Landwirtschaft
betreffen heute vier Pflanzenarten - Mais, Raps, Baumwolle, Soja - und
zwei Eigenschaften - Herbizidresistenz und Schädlingsresistenz.
Herbizidresistente Pflanzen werden zusammen mit einem Breitbandherbizid
des gleichen Herstellers angeboten, das alle Pflanzen auf dem Feld
ausser den erwünschten vernichtet. Seit Jahren angekündigt werden
Pflanzen, die den KonsumentInnen und nicht nur den LandwirtInnen
Vorteile bringen sollen: etwa besser schmeckende, vitaminreichere
Früchte oder gar solche, die pharmakologische Wirkstoffe enthalten.
2. Konsumieren wir heute bereits GVO-Produkte?
Produkte aus gentechnisch veränderten Organismen (GVO) müssen gemäss
Gentechnikgesetz deklariert werden, der Import von GVO ist
bewilligungspflichtig. Zugelassen sind hierzulande eine GV-Soja- und
drei GV-Maissorten. Allerdings verzichten fast alle Händler freiwillig
auf GVO; der Umfang des Imports ist minimal. Nicht deklarationspflichtig
sind Fleisch, Eier und Milchprodukte von Tieren, die mit GVO gefüttert
wurden. Vergangenes Jahr bestand ein halbes Prozent der
Futtermittelimporte aus GVO. (Ein Moratorium würde die Einfuhr von
Futter- und Lebensmitteln nicht verbieten.) Keine Deklarationspflicht
besteht für Textilien aus GV-Baumwolle.
3. Ist der Konsum transgener Produkte gefährlich?
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schreibt, es gebe «keine Daten
darüber, dass geprüfte Gentech-Lebensmittel nicht sicher sind».
Millionen Menschen weltweit, argumentieren BefürworterInnen, essen aus
GVO hergestellte Produkte, und es sind keine Gesundheitsschäden bekannt,
die nachweislich darauf zurückgehen. Allerdings hat bislang auch niemand
versucht, diesen Nachweis wissenschaftlich zu erbringen. Zumindest in
Fütterungsversuchen mit Tieren sind Schäden festgestellt worden, die
sich nicht eindeutig erklären lassen. 1998 fütterte der Biochemiker
Arpad Pusztai Ratten mit Kartoffeln, die mit einem Gen des
Schneeglöckleins ein Protein (Lektin) gegen Frassinsekten herstellen.
Die Ratten erkrankten, obwohl das Lektin selber, wenn es dem Futter
beigemischt wurde, die Ratten nicht schädigte. Offenbar löst die
Einbringung des Lektin-Gens in das Kartoffelgenom mehr aus als die
blosse Bildung von Lektin (vgl. Frage 10). Gentech-BefürworterInnen
zweifeln Pusztais Resultate an. Zu ähnlichen Resultaten wie Pusztai kam
2004 eine Studie, die im Auftrag des Agrokonzerns Monsanto erstellt
wurde und eigentlich hätte zeigen sollen, dass der Genuss des transgenen
Maises Mon 863 unbedenklich sei (vgl. Frage 9).
4. Gefährden GVO die Umwelt?
Gentechnisch veränderte Pflanzen können sich mit verwandten Arten
kreuzen. Falls transgene Pflanzen Eigenschaften aufweisen, die ihnen
einen Überlebensvorteil bieten, können sich diese, einmal freigesetzt,
in der Umwelt schnell verbreiten. Das kann die biologische Vielfalt
gefährden, zudem besteht die Gefahr, dass so genannte «Super-Unkräuter»
entstehen, da einige Nutzpflanzen sich mit Unkräutern kreuzen können
(etwa Sorghum mit dem Unkraut Aleppohirse oder Raps mit Rüpsen).
Strittig ist, in welchem Umfang solche Auskreuzungen stattfinden.
Ein weiteres Risiko ist der so genannte horizontale Gentransfer, bei dem
Pflanzengene in Mikroorganismen gelangen. Das ist vor allem dann
gefährlich, wenn Antibiotikaresistenz-Gene transferiert werden. Solche
wurden in den ersten Jahren der Gentechnik aus technischen Gründen
verwendet. Gentech-BefürworterInnen meinen, dass horizontaler
Gentransfer äusserst unwahrscheinlich sei; KritikerInnen weisen darauf
hin, dass auch aus einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit bei einer sehr
grossen Anzahl Pflanzen und Mikroorganismen eine reale Möglichkeit
resultiere.
Sicher ist: Das Risiko ist wenig erforscht. Nur rund hundert von tausend
Freisetzungsversuchen mit GV-Pflanzen in Europa wurden von
Risikoanalysen begleitet. Die weltgrösste Umweltschutz-Dachorganisation,
die World Conservation Union IUCN, die unter anderem 82 Staaten zu ihren
Mitgliedern zählt, forderte 2004 wegen der bestehenden Unsicherheiten
ein Gentech-Moratorium. Ein Nationalfondsprojekt über «Nutzen und
Risiken der Freisetzung von GVO» ist geplant; über dessen Bewilligung
entscheidet der Bundesrat diesen Herbst.
5. Ist Koexistenz möglich?
Grundsätzlich ist Koexistenz, das Nebeneinander von Landwirtschaft mit
und ohne GVO, eine asymmetrische Sache: Kreuzen gentechnisch veränderte
Pflanzen in das Feld des gentechfreien Betriebs ein, so kann dieser
seine Produkte nicht mehr als gentechfrei verkaufen, sobald ein
Grenzwert (0,9 Prozent) überschritten ist. Umgekehrt entsteht kein Schaden.
Koexistenz ist möglich, sagt eine im April 2005 veröffentlichte Studie
der Eidgenössischen Forschungsanstalt Reckenholz (FAL): Für Mais und
Raps müsste zwischen den Feldern, je nach Sorte, lediglich ein Abstand
von 25 bis 50 Metern eingehalten werden, zudem sei eine Reihe
technischer und organisatorischer Massnahmen nötig. Demgegenüber kommt
das Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) zum Schluss,
Koexistenz sei in der kleinräumigen Landwirtschaft der Schweiz
unwirtschaftlich: Beim Raps etwa wären Feldabstände von vier Kilometern
nötig. Weil Rapssamen sehr lange fruchtbar bleiben, kann eine
Auskreuzung auch noch nach Jahren stattfinden. Die Differenzen zwischen
FAL und FiBL rühren von verschiedenen Annahmen her: Die FAL hielt eine
Einkreuzung von 0,5 Prozent für tolerierbar. Das FiBL rechnete mit 0,1
Prozent, damit der Grenzwert auch dann eingehalten werden kann, wenn
Verunreinigungen aus verschiedenen Quellen sich kumulieren.
Das Gesetz will den Konsum GVO-freier Produkte ermöglichen. Weil
absolute Reinheit nicht garantiert werden kann, sieht die Verordnung
Grenzwerte vor. Das Ziel ist jedoch, Verunreinigungen möglichst zu
vermeiden und nicht die Grenzwerte auszureizen. Deshalb ist es sinnvoll,
mit tieferen Toleranzwerten zu rechnen.
6. Ist GVO-Landwirtschaft nachhaltig?
Wächst die Weltbevölkerung weiter wie bisher, wird es mehr
Nahrungsmittel brauchen. Zusätzlicher Landverbrauch und noch mehr
Einsatz von Agrochemikalien könnten die Ökosysteme zum Kollaps bringen.
Gentechnik helfe, dies zu verhindern, sagen ihre BefürworterInnen: Dank
Ertragssteigerung könne der Flächenbedarf reduziert werden; ausserdem
sinke der Bedarf an Agrochemikalien, weil ja schädlingsresistente
Pflanzen nicht mehr gegen Schädlinge gespritzt werden müssten. Das ist
teilweise korrekt, sagt etwa das FiBL - aber nur, wenn mit
konventioneller Landwirtschaft verglichen werde. Wird der Verbrauch an
Agrochemikalien, der Energie- und Wasserverbrauch, die
Bodenfruchtbarkeit, die biologische Vielfalt gemessen, schliesst der
Bio- gegenüber dem GVO-Landbau überall - und teilweise markant - besser
ab. Selbst der Minderbedarf an Chemikalien dank GVO im Vergleich mit der
konventionellen Landwirtschaft ist umstritten: Weil Schädlinge und
Unkräuter sich an die transgenen Pflanzen anpassen und ihrerseits
Resistenzen entwickeln, würden nur in den ersten Jahren weniger
Chemikalien gespritzt. Schliesslich lagert die Gentech-Landwirtschaft
einen beträchtlichen Teil ihrer Kosten aus, das heisst, der Anbau mag
für den einzelnen Betrieb ökonomisch interessant sein, aber die
(ökologischen) Folgekosten trägt die Allgemeinheit.
7. Hilft Gentechnik gegen Hunger und Unterernährung?
Transgene trockenheits- oder salzresistente Nutzpflanzen könnten in
Gegenden gedeihen, die heute unterversorgt sind; gegen Mangelkrankheiten
sollen transgene Pflanzen helfen, die besonders vitaminreich sind. Der
an der ETH entwickelte transgene Golden Rice enthält Betacarotin, aus
dem der Körper Vitamin A bildet. Er soll Millionen Kindern helfen, die
unter Vitamin-A-Mangel leiden und von Erblindung bedroht sind.
Aus entwicklungspolitischer Sicht fragt sich, ob die Vorteile
gentechnischer Lösungsansätze die Nachteile aufwiegen und ob sich die
Ziele auf anderem Weg nicht effizienter erreichen lassen. Die
Weltlandwirtschaftsorganisation (FAO) setzt auf Gentech, und auch einige
unabhängige Entwicklungsfachleute wie Welternährungspreisträger Per
Pinstrup-Andersen wollen diese Option offen halten. Für die Mehrheit der
Entwicklungsorganisationen aber ist Gentechnik der falsche Weg. Golden
Rice ist aus ihrer Sicht eine Hightechlösung für ein Problem, das durch
eine Monokultur-Hightechlandwirtschaft verursacht ist, die für den
Weltmarkt statt für lokale Bedürfnisse produziert: Das Problem ist
nicht, dass die traditionelle Nahrung zu wenig Betacarotin enthielte,
sondern dass die Menschen keinen Zugang dazu haben. Und was die
Trockenheitsresistenz angeht: Das Internationale Forschungszentrum für
Landbau in Trockenzonen in Aleppo (Icarda, siehe WOZ Nr. 41/04), das
keinerlei Berührungsängste zur Gentechnologie kennt, setzt auf
Lowtechmethoden zur optimierten Wassernutzung, auf konventionelle
Züchtung sowie auf «vergessene» Landrassen statt auf GVO, weil es sich
davon effizientere Lösungen verspricht.
8. Schaffen GVO neue Abhängigkeiten?
Für viele Gentech-KritikerInnen, aber auch für unabhängige
Gentech-BefürworterInnen sind neue Abhängigkeiten die gewichtigste
negative Folge des GVO-Anbaus. Diese liegt weniger in der Technologie
als in der Patentgesetzgebung und -praxis begründet, seit 1980 das
US-Bundesgericht erstmals ein Patent auf einen gentechnisch veränderten
Mikroorganismus für gültig erklärt hat. GVO sind heute mit
Urheberrechten belegt. Wer Saatgut kauft, kauft gleichzeitig eine -
beschränkte - Nutzungslizenz für diese Urheberrechte, die im Besitz der
Firma bleiben. Das verändert die Machtverhältnisse in der Landwirtschaft
radikal, betrifft insbesondere KleinbäuerInnen in Entwicklungsländern
und beeinflusst die Versorgungslage dieser Länder nachteilig. Der
GVO-Markt wird heute fast vollständig von vier Konzernen (Monsanto,
Syngenta, DuPont, Bayer) beherrscht. Industriekritische
Gentech-BefürworterInnen haben deshalb eine Initiative gestartet, die
sich an der Open-Source-Bewegung für freie Software orientiert und die
Produkte der Gentechnologie frei verfügbar machen will.
9. Kann man GVO-Herstellern trauen?
Nein. Bis im März 2005 exportierte Syngenta in Europa nicht zugelassenen
Bt-10-Mais als Bt-11-Mais deklariert aus den USA in die EU. Als das
bekannt wurde, sprach Syngenta von einem Fehler und beteuerte, die
beiden Maissorten seien fast identisch. Das war gelogen: Bt-10 enthält,
anders als Bt-11, ein (in Europa verbotenes) Antibiotikaresistenz-Gen.
Monsanto hat die Zulassung von Mon-863-Mais in der EU beantragt (das
Verfahren ist noch hängig). Dazu hat die Firma eine in ihrem Auftrag
erstellte, tausendseitige Studie eingereicht. Laut Zusammenfassung
wiesen Fütterungsversuche an Ratten diesen Mais als unbedenklich aus.
Doch die Zusammenfassung widersprach den Resultaten: An den Nieren der
gefütterten Ratten waren Schädigungen festgestellt worden (vgl. Frage 3).
Agrofirmen und gentech-freundliche Regierungen üben ausserdem Druck auf
die öffentliche Forschung und wissenschaftliche Journale aus. 2001
publizierte «Nature» ein Paper über Auskreuzungen transgenen Maises in
Mexiko. Die Studie ist umstritten - dieses Jahr publizierte «PNAS
online» eine Studie, die keine Spuren von GVO im mexikanischen Mais
feststellte -, doch wer immer Recht hat: Sicher ist, dass massiv Druck
auf die «Nature»-Redaktion ausgeübt wurde, der diese dazu brachte, sich
von der Studie zu distanzieren - ein bisher einmaliger Vorgang. Arpad
Pusztai (vgl. Frage 3) verlor, nachdem er öffentlich über seine
Lektin-Kartoffel-Versuche gesprochen hatte, auf Druck der britischen
Regierung seine Stelle.
10. Weiss man, wie künstlich verpflanzte Gene wirken?
Die Agrogentechnik beruht auf der Grundannahme, dass ein Gen, das im
Organismus X eine bestimmte Eigenschaft hat, im Organismus Y genau
gleich wirkt. Diese Annahme ist nicht vollkommen falsch. So bringt das
Gen, das im Bacillus thuringiensis ein Insektengift produziert,
Nutzpflanzen dazu, ebendieses Gift zu produzieren. Die Grundannahme
greift aber zu kurz. Schon die Definition von «Gen» ist unklar; Gene
können im selben Organismus auf verschiedene Arten wirken. Die
Mechanismen, die bestimmen, wann ein Gen wie wirkt, und das
Zusammenspiel der Gene sind bei weitem nicht abschliessend geklärt.
11. Gefährdet ein Moratorium den Forschungsplatz Schweiz?
Die Forschung wird vom Moratorium ausgenommen. Die GegnerInnen des
Moratoriums meinen aber, dieses setze «falsche Signale» und schade der
Forschung indirekt. Doch: Die Forschung gibt es nicht - es gibt
verschiedene Forschungsrichtungen, die miteinander um begrenzte
Fördermittel konkurrieren. Wer «forschungsfeindlich!» ruft, vergisst
meist zu fragen, welche Forschung gemeint ist. Derzeit wird in
Gentech-Forschung, da kommerziell lukrativ, weit mehr investiert als
beispielsweise in Biolandbauforschung. Wenn also das Moratorium die
Gentech-Forschung tatsächlich bremsen sollte, wäre dies schlicht ein
Korrektiv zu einer problematischen Schwerpunktsetzung.
12. Wäre ein Gentech-Moratorium mit internationalem Recht vereinbar?
Die Welthandelsorganisation (WTO) verbietet Handelshemmnisse, die nicht
auf wissenschaftlich begründeten Bedenken beruhen. Doch was
«wissenschaftlich» sei, lässt sich nicht so klar bestimmen. Zwischen der
EU und den USA ist seit Jahren ein Verfahren zu genau dieser Frage
hängig; in der EU selber hat der Europäische Gerichtshof Anfang Oktober
ein Moratorium in Oberösterreich für ungültig erklärt. JuristInnen
rechnen damit, dass das WTO-Schiedsgericht ein GVO-Importverbot für
ungültig erklären wird. Allerdings bräuchte es dazu ein Verfahren -
solange niemand die Schweiz vor der WTO einklagen würde, könnte das
Moratorium gelten.
Die Volksinitiative «für Lebensmittel aus gentechnikfreier
Landwirtschaft» verlangt, dass in der Schweizer Landwirtschaft keine
Pflanzen angebaut und keine Tiere gehalten werden dürfen, die
gentechnisch verändert sind. Das Verbot soll fünf Jahre lang gelten. Die
Schweizer Lebensmittelproduktion bekäme die Gelegenheit, sich mit einem
gentechnikfreien Angebot am Markt zu profilieren. Umfragen zeigen, dass
eine klare Mehrheit der KonsumentInnen eine gentechnikfreie
Landwirtschaft will.
WOZ vom 27.10.2005
www.woz.ch/artikel/inhalt/2005/nr43/Wissen/12399.html