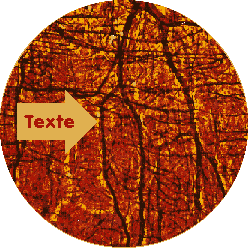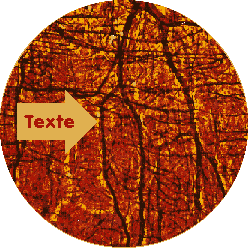Gedanken zu einem nicht ganz widerspruchsfreien Verhältnis.
Teil 1: "National"-Staat und "National"-Sprache
Nicht zuletzt in den Debatten um die so genannte "Integration" von ImmigrantInnen kehrt ein
Argument immer wieder: die Sprache als "Integrationsmarker". ImmigrantInnen, so wird wie
selbstverständlich konstatiert, hätten in Deutschland die deutsche Sprache zu erlernen. Hier
feiert unbemerkt eine Annahme fröhliche Urständ, die vor einhundert bis zweihundert Jahren und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in verschiedenen Ländern Europas noch zu Krieg, Vertreibung und Unterdrückung geführt hat; es wurde und wird wie selbstverständlich unterstellt, die BewohnerInnen eines einheitlichen "National"-Staats sollten eine einheitliche "National"-Sprache sprechen.
Dieser erste Teil der Artikelserie "Politik, "Nation" und Sprache" wirft einen Blick auf die
Zusammenhänge zwischen der Entstehung moderner "National"-Staaten und "National"-Sprachen. Er führt zunächst einige theoretische Gedanken aus und beschreibt danach die praktischen
historisch-politischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Die folgenden Teile der Artikelserie werden sich mit der Situation von Dialekten, mit den in der ArbeiterInnenbewegung des 19. Jahrhunderts vertretenen sprachpolitischen Positionen, mit der Entwicklung in andereneuropäischen Staaten und mit der Sprachpolitik der Europäischen Union befassen.
Gemeinhin wird die Französische Revolution als das "Gründungsdatum" der Idee moderner
Nationalstaaten ausgemacht. "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" war als Ausdruck der
Überwindung feudaler und absolutistischer Herrschaftsformen der wichtigste Ausdruck der
Vorstellung, daß eine Gesellschaft von prinzipiell gleichberechtigten Mitgliedern ihre
Herrschenden selbst bestimmen solle. Vom Absolutismus geerbt hat diese Vorstellung den
Zentralismus der Macht, der sich die Einzelnen fortan zu unterwerfen haben.
Und doch läßt sich der "National"-Staat weder auf die Elemente Gleichheit der "BürgerInnen" und Zentralismus der Macht beschränken, noch sind diese alleine ausreichend, um bürgerliche Staaten zu kennzeichnen. "National"-Staaten im modernen Sinn sind vielmehr als ambivalente Gebilde mit einer politisch-organisatorischen Struktur (dem Staat) und einer ideologischen Pendant (der Nation) zu verstehen. Noch im Mittelalter wurde politische Macht mit religiösen Argumenten legitimiert: die feudale Ordnung als göttliche Ordnung, an deren metaphysischer Spitze der vermeintliche Schöpfer mit langem weißem Bart daselbst sitzt und lenkt. Die modernen Nationalstaaten konnten und können auf solch einfach strukturierte Legitimationsmuster nicht mehr zurückgreifen. Dennoch ist ihr Selbstverständnis nicht weniger metaphysisch angehaucht: als Urkraft politischer Legitimation galt fortan nicht mehr Gott, sondern das "Volk" bzw. die "Nation" selbst.
Die Gleichheit des "Volkes" und dessen gleichberechtigte (vermeintliche oder tatsächliche)
Mitbestimmung ist für ein solches Legitimationsmuster ebenso wesentlich, wie es äußerliche,
vermeintlich objektive Merkmale und Symbole sind. Die Nation als "vorgestellte" oder "erfundene Gemeinschaft" (Benedict Anderson) brauchte Bezugspunkte, an denen sie sich selbst behaupten konnte: ein bestimmbares Territorium, geschichtliche Mythen, eine relativ einheitliche Massenkultur und Massenöffentlichkeit und nicht zuletzt eine vermeintlich einheitliche Sprache sind Faktoren, auf die sich die neu entstandenen "Nationen" berufen und mit denen sie ihre staatliche und ideologische Verfassung (mit zentralisiertem Gewaltmonopol) rechtfertigen. Die "Nation" erscheint vor diesem Hintergrund als Ziel und Höhepunkt eines genau so und nicht anders denkbaren Geschichtsverlaufes. Anders als für marxistische Ansätze dient Geschichte hier nicht der Erkenntnis des Gegenwärtigen, sondern dessen Rechtfertigung.
Es versteht sich weitgehend von selbst, daß solche politisch-gesellschaftlichen Umbrüche auch das Selbstverständnis der Einzelnen massiv tangierten. Die Entstehung von "Nationen" trug wesentlich dazu bei, daß in der Moderne "Identitäten" überhaupt erst entstehen konnten. Die "nationale" Identität nimmt dabei für sich in Anspruch, Priorität vor allen anderen Identitäten zu genießen - sie stellt damit das ideologische Gegenstück zum realhistorischen Machtzentralismus dar. Gerade weil es nur ein Machtzentrum - ein Machtmonopol des Staates - gibt, wird von Individuen die völlige und vorrangige Selbstidentifikation mit diesem verlangt.
Tatsächlich blieben andere Identifikationsangebote im historischen Rückblick hinter dem
"nationalen" zurück: so war beispielsweise das Bewußtsein, ProletarierIn zu sein, zwar im 19. Jahrhundert noch einigermaßen verbreitet, ist heute aber zumindest als primäres
Identifikationsangebot für die breite Masse nur noch von nachgeordneter Bedeutung. Mit dem Ende der Sozialistengesetze, spätestens aber nach 1900 wurde der "National"-Staat von SPD und Gewerkschaften zunehmend als Partner für soziale Verbesserungen akzeptiert, so daß sich
spätestens hier weite Teile der ArbeiterInnenbewegung dem neuen Machtzentrum und der Idee der "Nation" unterordneten. Das "nationale" Bewußtsein ersetzte das proletarische Sein - erkennbar spätestens daran, daß im Ersten Weltkrieg mit Billigung der SPD Arbeiter und Bürgerliche gemeinsam französische Arbeiter und Bürgerliche niederschossen.
Die Durchsetzung der modernen "National"-Staaten hing eng zusammen mit dem Siegeszug des
Kapitalismus. Das Gleichheitsideal, das dem Nationalismus des 18. und 19. Jahrhunderts zu Grunde lag, war unabdingbare Voraussetzung dafür, daß überhaupt Warenwirtschaft, Märkte und Lohnarbeit entstehen konnten. Staaten erfüllten dabei als "ideelle Gesamtkapitalisten" (Karl Marx) unter anderem die Aufgabe, das Marktgeschehen und den Warenaustausch überhaupt erst möglich zu machen: so ist zum einen das Staatsgebiet der maßgebliche territoriale Bezugsraum für Ökonomie und Ökonomietheorie. Zum zweiten aber kann die Rolle des Staates insbesondere bei den umfangreichen Normierungs- und Standardisierungsprozessen, von denen Kapitalisierung, Industrialisierung und Ausbau des Handels begleitet waren, kaum überschätzt werden. Es ist der Staat, der Zölle, Steuern und Abgaben angleicht oder abschafft und der unter seiner Hoheit eine einheitliche landesweite Währung einführt. Es ist der Staat, der Gewichts-, Längen- und andere Maße innerhalb seines Hoheitsgebietes (und später international) normiert. Und nicht zuletzt ist es der Staat, der auf seinem Territorium ein einheitliches Rechtssystem schafft.
Es ist auch der Staat, der zumindest den Anspruch hat, Produktion und Handel zu erleichtern, indem er die Sprache innerhalb seines Wirtschaftsraums standardisiert und normiert. Die Ausdehnung der Wirtschaftsräume verlief historisch mit der Standardisierung der Sprachen parallel. Dabei kommt der Anspruch, zu Gunsten eines einheitlichen Rechts- und Wirtschaftsraums eine einheitliche Sprache zu schaffen, der Funktion einer Sprache als Identifikationsobjekt der "Nation" entgegen. Während sich die "Nation" auf die einheitliche Sprache als Merkmal und Symbol der ideologischen Selbstabgrenzung beruft, erleichtert die Sprache das Wirtschaften innerhalb des betreffenden staatlichen Territoriums.
Nun ist allerdings keiner der vom 18. bis zum 20. Jahrhundert entstandenen europäischen
"National"-Staaten von Beginn an einsprachig gewesen. Vielsprachigkeit und dialektale Vielfalt waren die Norm. Die heute bekannten, landesweit gesprochenen "National"-Sprachen (wie das Deutsche, das Französische, das Spanische usw.) sind Ergebnis politischer Lenkung, die die Schaffung einheitlicher Standardsprachen zum Ziel hatte. Die Ausgrenzung und massive Unterdrückung Anderssprachiger war eher die Regel als die Ausnahme.
In Frankreich beispielsweise wurden und werden neben Französisch auch Katalanisch,
Niederländisch, Bretonisch, Okzitanisch, Deutsch, Baskisch und Korsisch gesprochen. Der Trend zum Französischen als landesweiter Sprache reicht dabei bis weit in die frühe Neuzeit zurück, die aktive und massive Ausgrenzung aller anderen Sprachen setzte aber verstärkt mit der Französischen Revolution und dem "National"-Staats-Gedanken ein.
In Deutschland verhielt es sich nicht wesentlich anders. Die sorbische Sprache beispielsweise, die heute in Brandenburg und Sachsen noch von ca. 67.000 Menschen benutzt wird, war schon im Spätfeudalismus unterdrückt. Generelle Sprachverbote sind seit dem 14. Jahrhundert nachweisbar. Diese Politik setzte Preußen im 19. Jahrhundert massiv fort, lediglich zeitweise begleitet von Phasen der Duldung. Schon Ende des 19. Jahrhunderts war die sorbische Einsprachigkeit weitgehend verschwunden. Ihren Höhepunkt erreichte die antisorbische Unterdrückungspolitik im Nationalsozialismus mit dem nicht selten gewaltsam durchgesetzten Verbot des Sorbischen in Medien, Öffentlichkeit, Kultur und Schule. Eine echte und dauerhafte Anerkennung des Sorbischen als Minderheitensprache gab es erst in und mit der DDR.
Preußen, um ein weiteres deutsches Beispiel zu nennen, okkupierte im Zuge der Teilungen Polens (1772, 1793, 1795) ein großes Territorium mit polnischer Bevölkerung. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entzog die Regierung den Polnischsprachigen zunehmend mehr Rechte, ihren Höhepunkt erreichte diese Entwicklung nach der Reichsgründung 1870/71. Die umfassenden
Germanisierungsmaßnahmen, die Schule, Lokalverwaltung, Medien, Wirtschaft und sogar das
Privatleben betrafen, rechtfertigte Reichskanzler Bismarck stets mit dem "bedrohten Deutschtum im Osten". Preußen war im 19. Jahrhundert auch der erste deutsche Staat, der in seinen Bevölkerungsstatistiken diejenigen als "Deutsche" bestimmte, die Deutsch sprachen. Der Bezug zur deutschen "Nation" und das Ideal, eine einheitliche Nationalsprache als Symbol für einen einheitlichen Nationalstaat durchzusetzen, ist offensichtlich.
Ein weiteres Beispiel nationalistisch motivierter sprachenpolitischer Auseinandersetzungen war Schleswig, Grenzgebiet zwischen Deutschland und Dänemark. Obwohl es sich dabei um ein traditionell mehrsprachiges Gebiet handelt, sind heute weitgehend nur noch die - ursprünglich dort gar nicht gesprochenen - Sprachen Dänisch und Deutsch übrig geblieben. Diese Entwicklung hat ihre Wurzeln schon im Mittelalter, ihren Höhepunkt fand sie aber im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Sowohl die dänische als auch die deutsche (preußische) Seite versuchte in einer Zeit häufiger Grenzverschiebungen die jeweilige Sprache durchzusetzen. Ab 1834 erließen die dänischen Regierungen umfangreiche Vorschriften über den Gebrauch der eigenen Sprache in Verwaltung, Öffentlichkeit und Kirche. Sie empfanden die deutschsprachigen Bevölkerungsteile Schleswigs als Bedrohung für die dänische "Nation". Umgekehrt erließ Preußen nach der Besetzung und Eingliederung Schleswigs 1864/1867 Vorschriften, welche die deutsche Sprache in Verwaltung und Öffentlichkeit stärken sollten; ab 1888 war die vollständige "Germanisierung" Schleswigs erklärtes Ziel der Regierung.
Den vor allem in den 1920er Jahren aus Polen und Rußland einwandernden so genannten "Ostjuden" begegnete man mit einem stark sprachlich gefärbten Antisemitismus: das von diesen ImmigrantInnen gesprochene Jiddisch wurde als Symbol der Selbstabgrenzung und des Undeutschen aufgefaßt. Bis 1933 war dieser Antisemitismus weniger eine Angelegenheit des Staates als der "einfachen" Deutschen. Es bedarf wohl keines Hinweises darauf, daß es dieselben Deutschen waren, die in den Vernichtungslagern nicht nur die weitaus meisten europäischen Juden ermordeten, sondern auch deren Sprache für immer zum Verschwinden brachten.
All dies war Teil eines Prozesses, an deren Ende die einheitliche deutsche "National"-Sprache als Symbol des deutschen "National"-Staates und als Kommunikationsmittel für einen möglichst einheitlichen Wirtschaftsraum steht. Das Deutsche, wie wir es heute sprechen und in dem auch dieser Artikel verfaßt ist, ist - wie mehr oder weniger jede "National"-Sprache - ein Kunstprodukt, geschaffen durch staatliche Politik und fungierend als Symbol der "Nation". Es ist eine blutige Sprache.
Patrick Schreiner