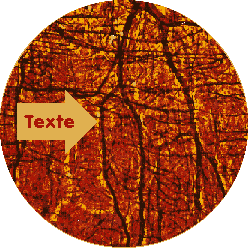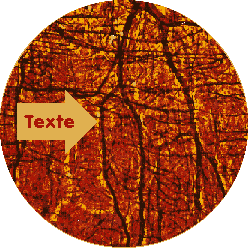Vor fünfzehn Jahren befreite ein kleiner Staat seine Wirtschaft von
allen Fesseln.
Neuseeland wurde zum globalen Vorbild für Ökonomen und Politiker.
Umso erschreckender die Bilanz: Niedriges Wachstum, hohe Schulden,
neue Armut.
Fünf Jahre und vier Monate, bevor in Europa der Eiserne Vorhang
fällt, kommt die Freiheit nach "Polen".
Sie kommt mit einem kleinen untersetzten Mann, der Ende Juli 1984 ein
bienenkorbförmiges Betongebäude betritt. Er steigt in den Aufzug,
fährt in den siebten Stock, geht in sein neues Arbeitszimmer und
schaut hinunter auf die Stadt zu seinen Füßen. Er sieht Cafes, denen
es nicht erlaubt ist, Stühle auf die Straße zu stellen, und
Restaurants, die zum Essen keinen Wein servieren dürfen. Er sieht
graue Verwaltungsgebäude, in denen Männer mit kurzen Hosen und krummen
Beinen sitzen und darüber entscheiden, ob es den Menschen im Land
erlaubt ist, Zeltstangen zu importieren.
Er sieht sein Heimatland, von Paragrafen gefesselt, vom Bankrott
bedroht. Er sieht Neuseeland. "Wie Polen!", denkt er sich. "Nur mit
mehr Sonne."
Der Mann heißt Roger Douglas. Er ist der neue Finanzminister, und er
beginnt diesen Job wie ein Chemiker: mit einem Experiment. Einem
Experiment, das auf der ganzen Welt noch niemand gewagt hat. Douglas
macht aus Neuseeland ein Soziallabor.
Er formt eine Gesellschaft, die wie keine andere von den Kräften des
freien Marktes regiert wird. So wird das kleine Land schnell zum
Modell der Globalisierungsepoche. An Neuseeland, schreiben Ökonomen
und Journalisten, könne sich der Rest der Welt ein Beispiel nehmen.
15 Jahre später ist das Experiment gescheitert. Im Herbst 1999
wählten die Neuseeländer eine neue Regierung an die Macht. Und während
sich im Rest der Welt der Staat aus der Wirtschaft zurückzieht, macht
sich diese Regierung daran, die Marktkräfte zu schwächen.
15 Jahre waren genug. So wie Chemiker heute wissen, wie Wasser und
Natrium aufeinander wirken, so glauben die Neuseeländer nun die
Antwort auf eine Frage zu kennen, die sich die Menschen heute überall
stellen: Wie reagiert ein Land auf den unregulierten Markt? Wird es
reicher? Schöner? Hässlicher?
Neuseeland 1984, das sind 3,5 Millionen Menschen und zwei Inseln
zwischen Australien und dem Südpol, zusammen etwa so groß wie das
italienische Festland. Das sind Männer, denen es nichts ausmacht,
tagelang keinen Menschen zu sehen, aber jeden Tag hundert Hügel und
tausend Schafe. Das sind Menschen, die stolz darauf sind, dass ihr
Land als der Geburtsort des Wohlfahrtsstaates gilt. Dass es in
Neuseeland keine Armen gibt und wenig Reiche, aber viele Wohlhabende.
"Achtzig Prozent der Neuseeländer hatten ein eigenes Haus", sagt der
Sozialhistoriker David Thomson von der Massey-Universität in
Palmerston North. Dazu oft noch ein Auto und ein Boot. Das war der
Unterschied zu Polen.
Allen war klar: So konnte es nicht weitergehen
Dass sie manchmal Monate warten mussten, bis der Staat das Telefon
montierte, fanden die zufriedenen Hausbesitzer nicht so schlimm. Der
Staat sorgte ja auch dafür, dass jeder Neuseeländer eine Arbeit bekam,
25.000 allein bei der Eisenbahn. Dort hatte zwar nicht jeder etwas zu
tun, aber die Leute hatten Jobs. Und der Staat hatte Schulden.
Mitte der Achtziger sahen die Neuseeländer ein, dass es so nicht
weitergehen konnte. Sie wählten die Labour-Partei an die Regierung,
Roger Douglas wurde Finanzminister.
Der sagt von sich selbst, das Reden und Verhandeln sei seine Sache
nicht. Und wie er das sagt, mit knappen Worten und kleiner Geste,
glaubt man ihm sofort. Er war nie ein Mann für die Massen, keiner, dem
sie zujubeln, kaum dass er die Stimme hebt. Das Land hat er trotzdem
verändert.
Wenige Wochen nach seinem Amtsantritt fährt Douglas von der
Hauptstadt Wellington nach Norden in die Provinz. Dort steht er dann
in einem anderen Betongebäude, einem flachen diesmal, in einem Saal
mit niedriger Decke und blauem Teppichboden. Tische und Stühle haben
sie nach draußen getragen, um Platz zu schaffen für die 1200 Menschen,
die ohnehin schon bis zu den Türen hinausquellen.
Von den Bauernhöfen im Umland sind sie gekommen, von den Wiesen und
den Hügeln, haben sich die Erde von den Schuhen gekratzt und die
Sonntagssachen angezogen. Nun steht dieser kleine Mann vor ihnen,
dieser mittelmäßige Redner, und sagt ungerührt, er werde ihnen alle
Subventionen und Steuervergünstigungen streichen. Nicht langsam
auslaufen lassen, sondern streichen, von heute auf morgen. Die
Subventionen für den Kunstdünger und für die Weidezäune, für das
Pflanzen von Bäumen, für die Aufzucht von Schafen und Kühen, und für
die Milch und die Wolle. Alles eben. Im Durchschnitt 35 Prozent ihres
Einkommens.
Die Bauern bekommen erst Angst, dann Wut. "Wir wollten ihm den Kopf
einschlagen", sagt Malcolm Bailey, der damals Ende zwanzig war und ein
kleiner Milchbauer aus der Kleinstadt Fielding, einer Stadt, die es
nicht gäbe ohne die Landwirtschaft. Hier verkaufen die Bauern ihre
Tiere und ihre Milch, hier gehen ihre Kinder zur Schule, und hier
treffen sie sich manchmal und reden über die kleine Unbill in ihrem
eigentlich recht glücklichen Leben.
Um dieses Leben fürchten sie jetzt. Wie ein Schatten steht Roger
Douglas über ihm, dieser Labour-Mann, den die Bauern ohnehin nicht
gewählt haben. Malcolm Bailey hat noch heute das Geschrei im Ohr, und
im Kopf die Erinnerung an die Leibwächter, die sich schützend vor den
Finanzminister stellten.
Die Bauern und ihr Einkommen schützte nun niemand mehr. Manche zogen
in die Stadt und kauften sich ein Taxi oder setzten sich im Supermarkt
an die Kasse. Ein paar schossen sich eine Kugel in den Kopf. Die
übrigen beschlossen zu kämpfen.
Den Bankrott vor Augen, entdeckten die Bauern den Unternehmer in
sich. Sie legten Farmen zusammen, teilten sich die Traktoren,
vermieteten das halbe Haus an amerikanische Touristen. Douglas
schaffte nicht nur die Subventionen ab, er strich auch die Zölle
zusammen. So wurden wenigstens die Maschinen aus dem Ausland billiger.
Vor allem aber hatten die Bauern das Glück, dass ihre Tiere im warmen
Klima Neuseelands keinen Stall brauchen und dass das Gras hier auch im
Winter wächst. Das war ihr Wettbewerbsvorteil auf dem Weltmarkt.
Nur einer von hundert Bauern ist Pleite gegangen. Auch Malcolm Bailey
hat sich durchgesetzt mit seinen Milchkühen. Irgendwann merkte er,
dass er nicht nur ein Talent für die Landwirtschaft hat, sondern auch
für die Politik. Einige Jahre war er Vorsitzender von Federated
Farmers, dem neuseeländischen Bauernverband, heute reist er im Auftrag
der Regierung durch die Welt und versucht andere Länder zu überzeugen,
die Subventionen zu streichen.
Die Bauern haben gelernt, wie Freiheit schmeckt
In Neuseeland, sagt Bailey, finde man heute kaum einen Bauern, der
die Uhr zurückdrehen wolle auf 1984. Manche haben weniger Geld, dafür
haben sie entdeckt, wie erhebend es sein kann, auf eigenen Beinen zu
stehen. Sie haben gelernt, wie gut Freiheit schmeckt.
Roger Douglas, der Mann, der das alles in Gang brachte, sagt, er habe
Freude daran, Dinge zu bewegen. Er selbst bewegte vor allem sein
Handgelenk. Der Premierminister war auf seiner Seite. Im Parlament
hatte die Labour-Partei die absolute Mehrheit.
So saß Douglas in seinem Arbeitszimmer im siebten Stock des
Betonbienenkorbs und unterschrieb Verordnungen. Gesetzentwürfe.
Hausmitteilungen. Konzeptpapiere. Ein kurzes Kratzen auf dem Papier,
und das Land ist verändert. Spitzensteuersatz? Von 66 runter auf 33
Prozent. Sonderabschreibungen? Streichen! Kapitalverkehrs- kontrollen?
Streichen! Preiskontrollen? Streichen! Importkontrollen? Streichen!
Die Zentralbank? Wird unabhängig! Der Zentralbankchef? Bekommt einen
erfolgsorientierten Arbeitsvertrag: Steigt die Inflationsrate über
einen bestimmten Wert, wird der Zentralbankchef entlassen! Die
Staatsbetriebe, Telekom, Eisenbahn, die Banken, Versicherungen?
Verkaufen, alle verkaufen!
"Viele haben damals nicht verstanden, was eigentlich passiert", sagt
Jackson Smith, National Secretary der Gewerkschaft Amalgamated
Workers. Douglas überrannte das Land. "Blitzkrieg" nennt der
neuseeländische Wirtschafts- wissenschaftler Brian Easton die Methode,
mit der Roger Douglas bewies, dass man auch demokratische Länder mit
ihren vielen Partikularinteressen umkrempeln kann, wenn man es richtig
anstellt.
Douglas selbst beschreibt seine Strategie so: "Man darf nicht
innehalten mit den Reformen, deine Gegner treffen dich viel schwerer,
wenn sie auf bewegliche Ziele feuern müssen."
Der das sagt, stammt aus einer alten Labour-Familie. Douglas' Vater
war ein strammer Sozialist, und er selbst hatte ähnlich angefangen. Er
war Buchhalter, bevor er in die Politik ging, glaubte an den Staat,
bevor er sah, wie staatsgläubige Politiker das Land dem Ruin
entgegentrieben. So verfiel er der liberalen Idee. Dem Glauben, dass
die Menschen die Wirtschaft am besten selbst organisieren, wenn man
sie nur machen lässt.
Wie es der große Ökonom Adam Smith einst schrieb: Egal ob Arbeiter
oder Kapitalanleger, jeder werde bei seinen Entscheidungen "von einer
unsichtbaren Hand geleitet". Die unsichtbare Hand, das ist der freie
Markt, und dieser sorge dafür, dass es am Ende nicht nur einigen
Einzelnen, sondern der gesamten Gesellschaft besser gehe, weil die
Wirtschaft effizienter werde.
Als Douglas auch den Arbeitsmarkt und das Sozialsystem deregulieren
wollte, tat das seinen Kabinettskollegen in der Labour-Seele weh. Die
Reformen gerieten ins Stocken.
Doch 1990 wählten die Neuseeländer eine neue, konservative Regierung
ins Amt. Die neue Finanzministerin setzte dort an, wo Douglas
aufgehört hatte. Sie kürzte das Arbeitslosengeld und die
Sozialleistungen um bis zu 27 Prozent. Vor allem aber hob sie die
Tarifverträge auf. Kein Unternehmer war mehr an kollektive
Arbeitsverträge gebunden. Überstunden- und Wochenendzuschläge fielen
weg. "Ein Unternehmer konnte zum Angestellten sagen: 50 Prozent
weniger Lohn, take it or leave it", sagt der deutsche Betriebswirt
Rolf Cremer, der die Business School der Massey-Universität leitet.
Mitte der neunziger Jahre - die Neuseeländer waren längst durch mit
ihren Reformen, als sich in den Industrieländern des Nordens die Angst
ausbreitete, auf die Verliererstraße zu geraten. Verschuldet,
verkrustet, verkrampft, lautete die Diagnose vieler
Wirtschaftswissenschaftler. Das lenkte den Blick auf die beiden
kleinen, immergrünen Inseln bei Australien und löste Begeisterung aus.
Endlich ein Land, das tat, was die Ökonomen sagten.
"Wäre das Wirtschaften eine olympische Disziplin, hätte Neuseeland
schon einen Haufen Goldmedaillen gewonnen", schrieb 1996 die
International Herald Tribune. Die amerikanische Heritage Foundation
und das Wall Street Journal bescheinigten der neuseeländischen
Wirtschaft einen höheren Freiheitsgrad als der ameri- kanischen.
Journalisten, Minister, Delegierte, Experten aus aller Welt machten
sich auf den Weg nach Süden. Unisono verkündeten sie: Mit Neuseeland
geht es aufwärts.
Man kann das sehen. Wo in den großen Städten früher Stummelhäuser
standen, ragen jetzt Bürotürme in den Himmel. Vom siebten Stock des
Regierungsgebäudes kann man längst nicht mehr über Wellington schauen.
Verglaste Geschäfts- häuser versperren den Blick. Und noch immer wird
gebaut.
Im Süden Aucklands zum Beispiel, ein gutes Stück außerhalb der Stadt,
hat die Regierung gerade neues Bauland ausgewiesen. Bald werden dort
Arbeiter Beton anrühren, Kräne werden Stahlträger in die Höhe hieven.
Baustellen zeigen, dass sich etwas bewegt im Land. Nur, in welche
Richtung? Was da im Süden Aucklands entstehen soll, ist ein neues
Gefängnis.
Fünf Jahre und vier Monate, bevor in Europa der Eiserne Vorhang fiel,
kam die Freiheit nach Neuseeland. Ein anderer Wind weht seitdem durchs
Land, und manche sagen, er sei angenehm frisch. Andere finden ihn
schneidend kalt.
Indem die Regierung das Arbeitslosengeld zusammenstrich, wollte sie
die Arbeitslosen zwingen, sich Arbeit zu suchen. Mit dem Geld vom
Staat kommen sie seitdem nicht mehr weit, doch manche entschieden sich
trotzdem gegen einen Job, oder sie fanden keinen.
In manchen Wohnbezirken von Auckland oder Wellington gibt es
inzwischen keine Straße mehr, in der die Einbrecher noch nicht
unterwegs waren. In manchen Vororten derselben Städte haben sich
Nachfahren der Maoris, der neuseeländischen Ureinwohner, in
Straßengangs zusammengeschlossen. Black Power nennt sich eine der
größten, nach amerikanischem Vorbild.
Der erste Teil der Verheißung stimmte: Die Ungleichheit stieg
Seit 1984 ist die Kriminalität in Neuseeland drastisch gestiegen, der
Anteil der Inhaftierten an der Gesamt- bevölkerung hat sich mehr als
verdoppelt. Auch der Gini-Koeffizient hat sich sprunghaft erhöht.
Der Gini-Koeffizient ist eine Maßzahl für den Abstand zwischen den
oberen und den unteren Einkommens- schichten. In Neuseeland ist er in
den vergangenen Jahren von einem der niedrigsten auf einen der
höchsten Werte der industrialisierten Welt gestiegen. Das allein muss
man nicht unbedingt schlimm finden. Verzeichnet ein Wohlhabender einen
Einkommensgewinn von zwanzig Prozent und ein weniger Wohlhabender
einen Zuwachs von zehn Prozent, dann vergrößert sich zwar der Abstand
zwischen Arm und Reich - aber beide haben mehr Geld als vorher.
Auf genau diesen Effekt zielten die Reformen in Neuseeland ab. Die
Befreiung der unsichtbaren Hand, so die liberale Verheißung, werde
zwar die ökonomische Ungleichheit erhöhen. Gleichzeitig aber werde sie
ein starkes Wirtschaftswachstum schaffen, das auch den unteren
Einkommensschichten Geld in die Taschen spült.
Die Zeitungen würden vom Boom schreiben, und die Fotografen würden
Bilder schießen von den Businessleuten in den Bankentürmen und den
dicken Schiffen, die im Hafen Waren aus Neuseeland laden.
Tatsächlich laufen in Wellington oder Auckland gut frisierte Männer
in dunklen Anzügen zwischen den Hochhäusern hin und her. Im Hafen
legen schwere Containerschiffe an und nehmen Fracht auf. Und doch
wusste Roger Douglas, als er die Gesetzesentwürfe unterschrieb, dass
er sich auf solche Bilder nicht verlassen konnte. Entscheidend ist,
wie viel Geschäft die Banken machen, wie viele Schiffe in die Häfen
kommen. Entscheidend sind die Zahlen, die der Finanzminister Monat für
Monat, Jahr für Jahr auf seinen Tisch bekommt.
Die Zahlen sind eindeutig. Zwischen 1971 und 1984 war die
neuseeländische Wirtschaft noch um jährlich 1,5 Prozent gewachsen.
Seit 1984 verzeichnet Neuseeland das niedrigste Wirtschaftswachstum
aller OECD-Länder: durchschnittlich 0,9 Prozent pro Jahr. Die
Arbeitslosenquote stieg von 4 auf 6 Prozent. Die Auslandsschulden
liegen über dem Bruttoinlandsprodukt.
In anderen Worten: Wäre das Wirtschaften eine olympische Disziplin,
hätte Neuseeland nicht einmal den Vorlauf überstanden.
Vor zwei Jahren sagte der Chef der neuseeländischen Zentralbank, der
Mann also, dessen Arbeitsplatz von der Höhe der Inflationsrate
abhängt: "Die Absicht der Reformen war nicht, eine abstrakte Theorie
zu testen, sondern die soziale und ökonomische Situation aller
Neuseeländer zu verbessern."
Schon damals konnte er die Folgen der Reformen an jeder Ecke
besichtigen. Da sind die vielen neuen Restaurants und die
Lebensmittelläden, die rund um die Uhr geöffnet sind. Da sind die
Bahnhöfe und Schulen draußen auf dem Land, die geschlossen wurden,
weil sie sich nicht mehr rentierten. Da ist dieses Krankenhaus in
Auckland, das sein Dach an den Elektronikkonzern Sharp vermietet,
dessen Reklame nun über der Stadt leuchtet. Da ist diese Schule, die
sich nach einer Transportfirma benannt hat, um ihr Budget
aufzubessern.
Und da ist dieser Teppichboden.
Gleich gegenüber einem der Bankentürme, sozusagen zu dessen Füßen,
hat in Auckland die Methodist Mission einige Räume bezogen. Büroräume
vor allem, aber auch diesen einen fensterlosen Raum, der so groß ist
wie eine kleine Turnhalle - eine Turnhalle mit Teppichboden.
Dieser Teppich war wohl einmal olivgrün oder braun, man sieht das
nicht genau, weil nicht klar ist, was Flecken sind und was die
ursprüngliche Farbe. Die Flecken kommen von verschütteter Suppe, von
Essensresten. Aber das scheint hier niemanden zu stören, weil das kein
Restaurant ist, sondern ein regensicherer Ort zur Nahrungsausgabe und
-aufnahme.
Gegen Mittag kommen sie dann von der Straße herein, manche hell-,
manche dunkelhäutig, manche Gesichter verschwinden in weiten Kapuzen,
verfilzte Haare hängen unter Baseballmützen hervor. Die Hosen und
Jacken, die sie tragen, haben vor ihnen schon anderen gehört. Es ist
der internationale Einheitslook der Obdachlosen.
Noch immer gibt es in der Millionenstadt Auckland weniger Obdachlose
als in den Großstädten anderer Industrieländer. Nur dass es sie in
Neuseeland früher überhaupt nicht gab. Und dass sie sozusagen dem
sozialen Trend vorauseilen.
Seit 1984 sind die Einkommen der unteren 50 Prozent der
neuseeländischen Bevölkerung gesunken. Lediglich die oberen 20 Prozent
haben deutlich dazugewonnen.
Wie konnte das passieren?
Das Verstörende am Neuseeland-Experiment ist weniger die Tatsache,
dass es Neuseeland ökonomisch nicht so gut geht. Vielen Ländern geht
es noch schlechter.
Was die jüngere neuseeländische Geschichte so interessant und
rätselhaft zugleich macht, ist: Hier haben nicht mächtige
Interessengruppen Reformen verhindert. Hier haben nicht Politiker
Politik gemacht, die nichts von Wirtschaft verstehen. So wie Platon
einst forderte, Philosophen sollten das Land regieren, so waren in
Neuseeland die Ökonomen an der Macht.
Vielleicht hätte man den Arbeitsmarkt etwas früher liberalisieren
sollen oder den Kapitalmarkt ein wenig später. Ansonsten aber haben
die Neuseeländer alles exakt so gemacht, wie es die ökonomische
Theorie vorsieht, und zwar nicht irgendeine Theorie, sondern die
vorherrschende, die an den großen Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultäten der Welt gelehrt wird. Wie also konnte das passieren?
Roger Douglas, der Mann, mit dem alles begann, ist mittlerweile zum
"Sir" geadelt. 63 Jahre ist er alt, sein Haar ist grau geworden, und
vermutlich würde es ihn freuen, wenn die Leute ihm etwas mehr
Dankbarkeit entgegenbrächten.
Vor einigen Jahren hat er die Labour-Partei verlassen und die
Act-Partei gegründet, eine Gruppierung, die sich ganz der liberalen
Idee verschrieben hat. Bei der vergangenen Wahl erhielt sie nur ein
paar Prozent der Stimmen.
Douglas hat sich aus der Politik zurückgezogen, er ist jetzt oft im
Ausland, hält Reden oder berät Regierungen, die ihr Land verändern
wollen. Er leugnet gar nicht, dass mit dem Land manches nicht zum
Besten steht. Er sagt, was fehle, seien weitere Reformen.
Weitermachen! Jetzt nicht aufhören, sagen auch die Vertreter
internationaler Institutionen wie der OECD. Viele Neuseeländer hören
das nicht mehr so gerne.
Ein Kommentator des New Zealand Herald, der größten Tageszeitung des
Landes, schrieb: "Wir haben es satt, dass unsere Denkfähigkeit
beleidigt wird von diesen anmaßenden Bürschchen, die sich Ökonomen
nennen, uns im Auftrag von irgendwelchen Finanzinstitutionen mit ihren
simplistischen Rezepten kommen und ihre Prognosen abgeben, die fast
immer falsch sind."
Auch Tim Hazledine ist Ökonom, Professor an der University of
Auckland und nur wenige Jahre jünger als Roger Douglas. Im englischen
Cambridge hat er gelehrt und im kanadischen Vancouver, vor acht Jahren
kehrte er zurück, sah zu, wie sich sein Heimatland veränderte, und
fing an, Fragen zu stellen. Schließlich hat er ein Buch geschrieben.
Es trägt den Untertitel "Die Ökonomie des Anstands". Darin rechnet
Hazledine vor, dass sich in Neuseeland das Verhältnis von Managern zu
Arbeitern vervielfacht hat. Offensichtlich sind diese Manager nötig,
damit die Arbeiter tatsächlich tun, was sie tun sollen, aber effizient
ist das nicht, und früher hat man sie nicht gebraucht. "Vielleicht",
sagt Hazledine, "braucht eine funktionierende Marktwirtschaft weniger
liberalisierte Märkte als Vertrauen und Loyalität."
Und: "Vielleicht hat die Liberalisierung dieses Vertrauen zerstört."
Hazledine hat diesen Ansatz nicht erfunden, er stammt ursprünglich
von dem kanadischen Soziologen James Coleman, der schon vor zehn
Jahren das Konzept des Social Capital entwickelte, womit er meinte,
dass nicht nur Maschinen oder technisches Wissen ökonomisch wertvoll
sind, sondern auch sozialer Zusammenhalt.
Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Arthur Okun hat das
einmal als den "unsichtbaren Handschlag" bezeichnet, aber natürlich
ist auch das wieder nur eine hübsche Metapher für etwas, das plausibel
klingt, aber deshalb nicht wahr sein muss.
Was also ist wahr? "Wahr ist", sagt Tim Hazledine, "dass wir nicht
wissen, warum manche Ökonomien um so vieles reicher sind als andere
oder warum manche um so vieles schneller wachsen als andere."
Der amerikanische Ökonom und Nobelpreisträger Robert Solow hat diese
Wissenslücke schon vor Jahrzehnten beschrieben. Die Neue
Wachstumstheorie hat versucht, die Lücke zu füllen, viel kleiner ist
sie dadurch nicht geworden, aber alle Zweifel wurden weggespült von
den ökonomischen Dogmen und Leitsätzen, die in den vergangenen Jahren
die Welt überschwemmten. Und schließlich nach Neuseeland kamen.
Vor 16 Jahren kam die Freiheit nach Neuseeland, und vor einem Jahr
haben die Neuseeländer eine neue Regierung gewählt, die der Meinung
ist, etwas weniger Markt sei vielleicht gesünder für das Land.
Es ist nicht so, dass diese nun alle Reformen zurücknimmt. Den
Spitzensteuersatz hat sie von 33 auf 39 Prozent erhöht, den
Arbeitsmarkt rereguliert, es gibt jetzt wieder Tarifverträge. "Closing
the Gap", "die Ungleichheit verringern", heißt der Slogan, mit dem die
Regierung ihre Politik verkauft.
"In der Vergangenheit sind wir von einem Extrem ins andere gefallen",
sagt Michael Cullen, und er sagt das im siebten Stock des
Betonbienenkorbs, in seinem Arbeitszimmer. Cullen ist der neue
Finanzminister. "Wir versuchen jetzt, einen Mittelweg zu finden", sagt
er.
Einen Mittelweg, für den es keine rechte ökonomische Theorie gibt,
aber das kümmert Cullen nicht so sehr. Sie versuchen es eben. In
Neuseeland regieren jetzt wieder Politiker.