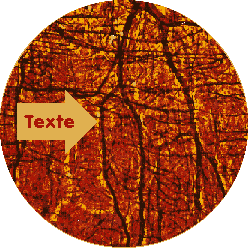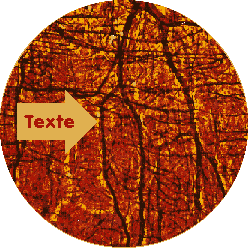Die Demokratie in Deutschland
und die Eigentumsverhältnisse in den Medien
Nehmen wir mal an, ich wäre Verleger einer regionalen Monopolzeitung; sagen wir im Westerwald. Und konstruieren wir den Fall: Mein Sohn
hätte Drogenprobleme, die Polizei hätte ihn bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erwischt, die Staatsanwaltschaft hätte ihn
angeklagt, ein Amtsrichter hätte das Verfahren eröffnet - und das alles hier bei mir im Westerwald. Würde ich es dann zulassen, daß einer
meiner Redakteure in meinem Blatt diese rein private Angelegenheit öffentlich macht? Dürfte ich es dulden, daß mein Blatt dazu mißbraucht
wird, den Jungen, der später einmal das Unternehmen leiten soll, und damit die ganze Familie in Verruf zu bringen, also dem Unternehmen zu
schaden? Niemals könnte ich das verantworten. Schlimm genug, daß der Junge in Gefahr ist, verurteilt zu werden. Würde nicht besser einer
meiner Redakteure mal kritisch darstellen, was in diesem Amtsgericht vorgeht, was das für Juristen sind, die es wagen, so rücksichtslos gegen
uns vorzugehen? Wofür bin ich denn Verleger, wenn ich mein Blatt nicht mehr für meine Interessen nutzen dürfte? Das Eigentum und sein freier
Gebrauch stehen doch bei uns, bitte schön, immer noch unter Grundrechtsschutz.
Beenden wir diesen fiktiven Monolog über einen nicht ganz fiktiven Fall und wenden wir uns statt dessen zum Beispiel Alfred Neven DuMont zu,
dem Verleger des Kölner Stadtanzeigers. Als die IG Metall begann, die 35-Stunden-Woche zu fordern, mahnte er die Redaktion schriftlich zur
Zurückhaltung - später könne ja auch die eigene Branche von solchen Forderungen betroffen sein.
Die Meinungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern über eine Arbeitszeitregelung - im Presse- ebenso wie im Metallunternehmen - konnten,
ja mußten auseinandergehen. Gerade deswegen erhob der Arbeitgeber Neven DuMont den Anspruch, über die Tendenz von Veröffentlichungen
über dieses Thema zu entscheiden.
Dieser Verleger gebietet inzwischen über das Pressemonopol in Köln und Umgebung, nachdem er zum Kölner Stadtanzeiger und regionalen
Boulevardblatt express auch die konkurrierende Kölnische Zeitung erworben hat. Nach der "Wende" konnte er sich überdies die Mitteldeutsche
Zeitung in Halle aneignen. Die Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (auch im Rundfunk) aufzulisten würde zu weit führen.
Seit langem spielt Neven eine wichtige Rolle im Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), zeitweilig war er dessen Präsident. Er war
auch tonangebend beteiligt, als in den 1970er Jahren Tarifverhandlungen zwischen den Journalistenorganisationen und dem BDZV über eine von
den Redakteuren geforderte "Kompetenz- abgrenzung" geführt wurden ("innere Pressefreiheit" war damals die Parole). Die Verleger, denen ein
Vertrag darüber von vornherein zuwider war, ließen sich eine Zeitlang auf Verhandlungen ein und erklärten sich bereit, den Redakteuren eine
"Detailkompetenz" einzuräumen, sofern klargestellt sei, daß die "Grundsatzkompetenz" bei ihnen, den Eigentümern des Pressebetriebs,
liege. Die Verhandlungen scheiterten, als die Verleger zusätzlich eine "Richtlinienkompetenz" beanspruchten. Wenn zum Beispiel, so
erläuterten sie, im Verbreitungsgebiet des Blattes eine Landratswahl anstehe, müsse der Verleger das Recht haben, darüber zu entscheiden,
wie im Blatt über die einzelnen Kandidaten geschrieben werde, denn hier könnten seine unmittelbaren Interessen berührt sein. Das heißt: Die
Verleger wollten von ihrer publizistischen Macht nichts abgeben. Und dabei ist es geblieben; ihre Macht ist derweil permanent gewachsen.
Unisono dasselbe Lied
Die Demokratie in Deutschland - und in anderen Ländern desgleichen - ist den Eigentumsverhältnissen in den Medien unterworfen. Aber wer
merkt es?
Der größte Pressekonzern in Deutschland ist der Axel-Springer-Verlag. Ihm gehören Bild und Welt, Bild am Sonntag, Welt am Sonntag, BZ (Berliner zeitung),
Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt und vieles mehr. Die bei Springer beschäftigten Journalisten sind allesamt auf das
marktwirtschaftliche System verpflichtet, den Kapitalismus. Es ist ihre Aufgabe, den vielen Millionen Lesern von Springer-Zeitungen und
-Zeitschriften immerzu die Botschaft einzuträufeln, der Kapitalismus sei gut für sie, besser als alles sonst Erdenkliche, einfach das Bestmögliche.
Zum Springer-Konzern gehören auch die Lübecker Nachrichten, die Monopolzeitung in Lübeck und Umgebung. Wie alle Springer-Zeitungen
preist dieses Blatt tagtäglich die Konkurrenz, den freien Markt, auf dem sich alles zum Besten fügt. Wer bemerkt diesen grotesken
Widerspruch, diese Verlogenheit: daß ein Monopolblatt den freien Markt preist?
In den meisten Regionen Deutschlands erscheint nur noch je eine Zeitung. Im Bundesland Rheinland-Pfalz beispielsweise gibt es vier
Tageszeitungen, je eine in den vier (früheren Regierungs-) Bezirken Mainz, Koblenz, Ludwigshafen und Trier; die Verbreitungsgebiete sind
genau gegeneinander abgegrenzt.
In Ostdeutschland erschienen bis 1989 neben den SED-Bezirks- zeitungen noch Zeitungen der anderen Parteien, die aber, auch wenn sie sich in
Einzelheiten unterschieden, alle den Sozialismus und die damaligen Machtverhältnisse priesen. Die SED-Bezirkszeitungen wurden dann
sämtlich von westdeutschen Pressekonzernen übernommen; die anderen Blätter wurden eingestellt. Die in Monopolzeitungen umgewandelten
früheren SED-Blätter preisen jetzt alle den Kapitalismus und die heutigen Machtverhältnisse.
Monopolisierung
Obwohl die regionale Monopolisierung der Presse auch in Westdeutschland weitgehend - bis auf wenige Regionen wie Berlin, München,
Frankfurt/Main, Düsseldorf - abgeschlossen ist (teilweise mit dem Ergebnis, daß zwar noch zwei Zeitungen nebeneinander erscheinen, die
aber demselben Verlag gehören, so in Hannover und Nürnberg), geht die Pressekonzentration weiter. Die großen Konzerne erbeuten nach und
nach die Monopolblätter, wie es Springer in Lübeck getan hat. Der Holtzbrinck-Konzern zum Beispiel (Die Zeit, Handelsblatt, Der Tagesspiegel
u. a.) hat sich den Südkurier, die Lausitzer Rundschau und die Saarbrücker Zeitung (die einzige Zeitung im Saarland) zugelegt, und jedes
Holtzbrinck-Blatt stimmt mit jedem Springer-Blatt im Lobpreis des Kapitalismus überein, der angeblich die Grundlage aller Freiheit ist. Und die
Blätter des Bertelsmann-Konzerns (Gruner+Jahr), des Essener WAZ-Konzerns und der anderen großen Verlage singen unisono dasselbe Lied.
Wo einmal ein Monopol besteht, da kann Konkurrenz nicht wiedererstehen. Kleine Versuche hat es gelegentlich hier und da gegeben. In
Osnabrück und Umgebung, wo schon seit Jahrzehnten die Neue Osnabrücker Zeitung allein erscheint, trat einmal eine Neue Freie Presse mit
der Parole "Brecht das Meinungsmonopol der NOZ" an. Der Versuch war schnell gescheitert. Selbst der reiche Heinrich-Bauer- Verlag schaffte
es nicht, in dem kleinen Verbreitungsgebiet der Husumer Nachrichten ein Konkurrenzblatt zu etablieren. Aber nach der "Wende" bedachte ihn
die Treuhandanstalt mit der Volksstimme, der früheren SED-Zeitung im Bezirk Magdeburg und Umgebung. So konnte dieser mächtige
Zeitschriftenkonzern endlich doch ins Zeitungsgeschäft hineinwachsen.
All diese Monopolzeitungen agitieren für das Privateigentum an der Presse, für die Privatwirtschaft überhaupt und für die Privatisierung alles
dessen, was noch gemeinwirtschaftlich ist: Nahverkehr, Wasserversorgung, Kliniken, zuletzt wahrscheinlich auch noch Schulen und
Gefängnisse, jedenfalls soweit sich daraus Geld schlagen läßt.
Albrecht Müller, einst Berater und Redenschreiber Willy Brandts, konstatierte Anfang 2003 in der Frankfurter Rundschau: "Einer sagt: Mit dem
Umlageverfahren ist die Altersversorgung nicht mehr zu finanzieren - und alle einflußreichen Multiplikatoren sagen es nach. Einer sagt: Wir
leben in einem Gewerkschaftsstaat - und Hunderte sagen es nach. Einer sagt: Keynes ist out - und von Abertausenden schallt es zurück.
Einer sagt: Wir brauchen endlich einen Niedriglohnsektor - und Legionen wiederholen es. Usw., usw. Dadurch, daß viele das Gleiche
wiederholen, wird die Lüge zur Wahrheit, diagnostizierte George Orwell."
Sie agitieren gegen das Tarifvertragsrecht, gegen das Streikrecht, gegen das Koalitionsrecht. Sie agitieren für die Lockerung, möglichst
Abschaffung des Kündigungsschutzes, für die Verlängerung der Arbeitszeit bis hin zur Aufhebung aller Arbeitszeitregelungen, für die Senkung
der Lohnkosten, also der Löhne und aller Sozialabgaben, zu denen die Unternehmer je verpflichtet worden sind, und mit der Hingabe eines
Kirchenchores verbreiten sie die frohe Botschaft, der Sozialabbau werde den wirtschaftlichen Aufschwung bringen, der dann auch Arbeitsplätze
schaffen werde.
Das alles ist so inhuman wie irrsinnig - aber gerade deswegen ist dieser gewaltige publizistische, nein propagandistische Aufwand erforderlich,
damit das Volk nicht auf andere, realistischere Gedanken kommt.
So werden Politiker gemacht
Die Medien haben in Deutschland viel Freiheit. Sie dürfen über alle möglichen Absonderlichkeiten berichten, auch über frei erfundene, und
manchmal zeigen sie sich zu starkem Engagement imstande, so Springers BZ zeitweilig für den armen "Euro-Fritz", den die Berührung von
Geldscheinen angeblich impotent gemacht hatte; die Zeitung führte ihm Frauen zu, die ihn sexuell stimulieren sollten.
Aus der Macht der Medien, einzelne Menschen bekannt zu machen, hat sich ein glänzendes Geschäft entwickelt: das Show-Geschäft. Ohne
die Medien kann niemand bekannt werden. Wegen welcher Eigenart oder Fähigkeit sie einen Menschen bekannt machen, ist nicht
entscheidend; hier zählt nur der Effekt, eben die Bekanntheit - die sich vielfältig nutzen läßt. Wenn einer Schlager singt, interessiert an ihm
nicht nur die Stimme, und am Fußballspieler interessieren nicht nur die Beine, sondern er darf auch Schlager singen, und besonders wichtig
sind seine Liebschaften. Je öfter einer erwähnt und möglichst auch im Bild gezeigt wird, desto höher steigt sein Marktwert. Schließlich darf er
sogar für Gummibärchen oder Telekom-Aktien werben, wodurch seine Bekanntheit und sein Einkommen Spitzenwerte erreichen. Ghostwriter
drängen sich ihm auf, die ihn auch zum Buchautor machen; unabhängig vom Inhalt des Buches ist von vornherein eine hohe Auflage garantiert.
Die Berichterstattung über Pressebälle, auf denen die kleinen Stars um die großen kreisen, indiziert den Marktwert jedes einzelnen. Es versteht
sich von selbst, daß nur derjenige Marktwert bekommen darf, der sich als Werbeträger für das marktwirtschaftliche System eignet. Daß er -
eigentlich ein Nobody - ihn bekommt, gilt als Beweis für die Güte dieses Systems.
So werden auch Politiker gemacht. Ein Beispiel aus den USA: Der mittelmäßige Hollywood-Schauspieler Ronald Reagan hatte erfolgreich im
Fernsehen für Seifenartikel geworben; außerdem hatte er unter McCarthy Kollegen als Kommunisten denunziert. Kalifornische Multimillionäre
befanden: Wer Borax-Produkte an den Mann und vor allem auch an die Frau bringe, der könne, wenngleich eigentlich Mitglied der
Demokratischen Partei, auch die Politik der Republikanischen Partei verkörpern und Gouverneur von Kalifornien werden. Sie finanzierten seinen
Wahlkampf, und er wurde Gouverneur. Ähnlich inzwischen Arnold Schwarzenegger.
Auch wer in Deutschland Kanzler werden will, kann nie genug Fernsehauftritte bekommen. Für den zeitweiligen niedersächsischen
Ministerpräsidenten Gerhard Schröder war es besonders nützlich, als er in der Fernsehfilmserie "Der große Bellheim" den Ministerpräsidenten
spielen durfte.
Nachdem sich Gerhard Schröder 1996 in Hamburg auf einer Bundesversammlung des CDU-Wirtschaftsrates vorgestellt hatte und dort für
geeignet befunden worden war, die Nachfolge des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl anzutreten, taten alle deutschen Medienkonzerne,
was sie konnten, um die SPD zu bewegen, Schröder als Kanzlerkandidaten aufzustellen. Die letzte Hürde, die er nehmen mußte, war die
niedersächsische Landtagswahl im Frühjahr 1996. Nie unterstützten die Medien dermaßen entschlossen und geschlossen einen
SPD-Kandidaten wie in jenem Landtagswahlkampf, und erfolgreich suggerierten sie, daß sich dort entscheide, welcher Sozialdemokrat bei der
Bundestagswahl gegen Kohl antrete. Unter dem Druck der Medien knickte die SPD ein - die sich vorher deutlich gegen Schröder entschieden
hatte.
Sobald Schröder zum Kanzler gewählt war, übten die Medienkonzerne doppelten Druck aus: Erstens prügelten sie auf die SPD ein, sich
Schröders Politik zu eigen zu machen, auch und gerade wenn diese Politik den Beschlüssen der Partei und dem Programm, mit dem sie sich
zur Wahl gestellt hatte, widersprach. Zweitens ließ vor allem der Springer-Konzern - an den sich Schröder eng anlehnte und von dem er sich
einen stellvertretenden Chefredakteur der Bild-Zeitung, der ihm schon als Biograph gedient hatte, als Regierungssprecher holte - den Kanzler
bald spüren, daß grundsätzlich die CDU zum Regieren ausersehen ist und daß es Mittel und Wege gibt, regierende Sozialdemokraten
abzulösen: In Hamburg schrieben damals Bild und Hamburger Abendblatt einen ebenso dummen wie reaktionären Amtsrichter zum politischen
Hoffnungsträger hoch und verschafften ihm rund 20 Prozent der Stimmen. Mit diesem Koalitionspartner konnte dann die CDU die
Landesregierung übernehmen, was ihr aus eigener Kraft nicht möglich gewesen wäre.
Es geht noch viel direkter und brutaler, wie wir aus Italien wissen. Da kauft sich der reichste Unternehmer des Landes Zeitungen und
Rundfunkanstalten, kandidiert selbst für das Amt des Minister- präsidenten, das er in einer Koalition mit Separatisten und Neofaschisten auch
erhält, und nutzt fortan zusätzlich auch die staatlichen Sender für eine Propaganda, die seinen persönlichen Interessen dient, z. B. dem, vor
Strafverfolgung geschützt zu werden.
Im Mai 2003 verbot Berlusconi den Journalisten in den von ihm abhängigen Medien, einen Wahlerfolg der Linken bei Regionalwahlen als Erfolg
darzustellen. Im Juni verbot er ihnen, über ein von der Linken in Gang gebrachtes Referendum zur Sicherung und Stärkung des
Kündigungsschutzes zu berichten. Die Totschweigetaktik war erfolgreich: Das Referendum - erschwert auch durch Differenzen innerhalb der
Linken - scheiterte an zu schwacher Beteiligung.
Kritische Wissenschaft?
Eine freie Presse ist laut Bundesverfassungsgericht "schlechthin konstituierend" für die Demokratie. Wie frei die Presse ist (frei wovon? frei
wozu?) und welchen Gebrauch sie von ihrer Freiheit macht, müßte permanent untersucht werden: von Medienwissenschaftlern, von
Bürgerrechtsorganisationen, von Gewerkschaften.
Die Gewerkschaften wehren sich kaum noch gegen die unablässige Diffamierung in den Konzernmedien; es ist sehr lange her, seit die IG
Metall einmal Professor Erich Küchenhoff beauftragte, die antigewerkschaftliche Hetze der Bild-Zeitung zu analysieren.
Um so erfreulicher, daß sich eine Bürgerrechtsorganisation, das Komitee für Grundrechte und Demokratie, im neuen Jahrbuch mit dem Thema
"Medien, Bürgerrechte und Politik" befaßt. Das erinnert mich an das Komitee für Abrüstung und Demokratie, das 1967 das heute noch
nützliche Buch "Imperium Springer" herausgebracht hatte, dessen Befunde die 68er Forderung "Enteignet Springer!" nahelegten.
Die Medienwissenschaft dient weitgehend den Medienkonzernen und der werbungtreibenden Wirtschaft, die möglichst genau wissen wollen, mit
welchen Methoden sie noch intensiver auf die Öffentlichkeit und aufs Unterbewußtsein der Konsumenten einwirken können, um ihre Interessen
durchzusetzen. Solche Studien bleiben uns meist verborgen. Aber gelegentlich kommen auch Studien mit demokratischer Tendenz zustande
wie die von Norbert Jonscher über "Inhalte und Defizite des lokalen Teils in der deutschen Tagespresse" als Dissertation an der Universität
Göttingen. Da können wir dann erfahren, daß alle vier untersuchten Monopolzeitungen im östlichen Niedersachsen die Aufgabe, umfassende
und vielfältige Informationen und Meinungen zu vermitteln, durch die den Lesern eine eigene Meinungsbildung zu kommunalpolitischen Themen
ermöglicht würde, "nicht oder nur mangelhaft erfüllen", indem sie unliebsame Themen (z. B. Umweltverschmutzung durch ortsansässige
Unternehmen) bewußt vernachlässigen und auf Kritik und Kontrolle von Politikern und Behörden weitgehend verzichten. Über bestimmte
gesellschaftliche Bereiche wie Kirche und Wirtschaft werde fast nie negativ berichtet. In den Lokalteilen, so Jonscher, tauchten immer die
gleichen Handlungsträger auf (Parteien, Vereine, Bürgermeister), andere kämen äußerst selten zu Wort. Meist werde über Veranstaltungen
berichtet, Hintergrundinformation fehle gewöhnlich. Konsequenz: "Nicht nur die Partizipationsmöglichkeiten der Bürger werden erschwert, auch
ihr allgemeines Demokratiebewußtsein wird durch diese Nichtbeteiligung an unmittelbar interessierenden, überschaubaren
kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen geschwächt."
Enttabuisierung des Militärischen
Die Mängel im Lokalteil sind noch harmlos im Vergleich zu denen in der außenpolitischen Berichterstattung. Eine Grundtendenz der typischen
bundesdeutschen Monopolzeitung ist ihre Mitwirkung an der "Enttabuisierung des Militärischen", derer sich Bundeskanzler Schröder rühmt.
Immer schamloser werden militärische "Lösungen" propagiert, zu denen es "keine Alternative" gebe. Die Notwendigkeit kriegerischer Gewalt
wird dadurch suggeriert, daß die Gegenseite nicht zu Wort kommt. So wird der Eindruck erweckt, als könne man mit ihr nicht reden. Zum
Beispiel wurde vor, in und nach dem NATO-Krieg gegen Jugoslawien der damalige jugoslawische Staatspräsident Slobodan Milosevic täglich
x-mal erwähnt, aber er erhielt niemals selbst das Wort - bis heute nicht, auch nicht in der Berichterstattung über den Prozeß gegen ihn in Den
Haag. Ganz im Sinne der Aggressoren (US-Präsident, NATO, Bundesregierung) gelten diejenigen, gegen die sich die Aggression richtet, als
urböse, so daß es sich geradezu verbietet, ihnen Gehör zu geben oder mit ihnen zu reden. Und dann bleibt eben nur Waffengewalt gegen sie.
Häme über Friedensbewegung
Als sich 2002 die Absicht der US-Regierung abzeichnete, den Irak zu besetzen, veranstalteten Friedensgruppen - Internationale Ärzte gegen
Atomkrieg (IPPNW) und andere - in Berlin einen Kongreß, auf dem viele namhafte Fachleute wie der frühere US-amerikanische
Waffeninspekteur Scott Ritter, der frühere UN-Beauftragte im Irak, Hans Graf Sponeck, Iraker verschiedener politischer Herkunft etc.
teilnahmen. Die großen Berliner Zeitungen informierten ihre Leser mit keiner Zeile. Alle Lügen, mit denen die US-Regierung ihre Kriegspolitik zu
rechtfertigen versuchte, wurden damals bereits gründlich widerlegt - aber der Großteil der Bevölkerung, der den jeweiligen regionalen
Monopolblättern vertraut, erfuhr nichts davon.
Über die Friedensbewegung war fast nur Hämisches zu lesen, z. B. auch in der vergleichsweise liberalen Süddeutschen Zeitung, die über
Konstantin Wecker, als er Anfang 2003 in den Irak reiste, um sich selbst ein Bild zu machen, herzog: "Was will er in Mossul? Da liegt nicht
mal Schnee." Erst als am 15. Februar in Berlin eine halbe Million Antikriegsdemonstranten zusammenströmten (und noch viel mehr in anderen
Städten rund um den Globus), erschienen zeitweilig Artikel, die die Friedensbewegung ernster nahmen. Aber eigene Recherchen der deutschen
Medien im Irak unterblieben weiterhin. Das gilt auch für die öffentlich-rechtlichen Medien. Ein Fernsehteam des Westdeutschen Rundfunks, das
eine Reportagereise nach Bagdad mit dem Arbeitstitel "Dem Feind ein Gesicht geben" vorbereitet hatte, wurde kurz vor dem Ziel
zurückgerufen.
Seit dem 11. September 2001 wird dem Publikum eingeredet, "die zivilisierte Welt" müsse weltweit "gegen den Terror" Krieg führen. Zum
Beweis dieser angeblichen Notwendigkeit genügten Bilder der einstürzenden Türme des Welthandelszentrums in New York. Nachfragen, was
sich damals im einzelnen ereignet hat, unterblieben lange Zeit, obwohl die offiziellen Darstellungen äußerst lückenhaft und widersprüchlich
waren. Es ist wie ein religiöses Tabu: Die US-regierungsamtliche Verschwörungstheorie, wonach islamistische Selbstmordattentäter unter dem
Kommando des geheimnisvollen Osama bin Laden das Verbrechen begangen haben, muß fraglos akzeptiert werden und als Begründung für
den "Jahrhundertkrieg gegen den Terror" ausreichen. Die tonangebenden deutschen Medien halten sich daran und fallen gehässig über
einzelne Publizisten her, die auf Ungereimtheiten hinweisen.
Die Berechtigung, weltweit militärisch zu intervenieren (wie in den amtlichen militärpolitischen Richtlinien der BRD schon seit 1992 verlangt), will
man sich nicht nehmen lassen, nachdem man sie sich in jahrelanger Mühe angemaßt hat. Tatsächlich bedurfte es einer außergewöhnlichen
Kraftanstrengung der deutschen Medien in den 90er Jahren (nachdem sich Deutschland 1990 im 2+4-Vertrag verpflichtet hatte, die Bundeswehr
ausschließlich zu Verteidigungszwecken einzusetzen, wie es ja auch im Grundgesetz steht), um die Bevölkerung glauben zu machen, es gebe
ein Recht oder gar eine Pflicht zum Angriffskrieg.
Im Gleichklang mit strammen Politikern - andere Stimmen durften nicht durchdringen - verkündeten die Monopolmedien, Deutschland müsse
nun, nachdem es vereinigt sei, endlich "normal werden", es müsse außenpolitisch "erwachsen werden", es müsse "Verantwortung
übernehmen". Gemeint war mit all diesen Worten nur eins: Deutschland müsse wieder bereit werden, in den Krieg zu ziehen.
Journalistische Fertigware
Nun ist die Bundeswehr in etlichen Ländern im Einsatz. Das Publikum erfährt darüber wenig. Gar nichts erfährt es über das Kommando
Spezialkräfte (KSK), das nach dem 11.9.2001 zum Zweck der Terroristenbekämpfung aufgestellt und - unabhängig von der Schutztruppe für die
neue Regierung in Kabul - nach Afghanistan geschickt wurde. Über dessen Wirken informiert die Bundesregierung weder Presse noch
Parlament, nicht einmal den Verteidigungs- ausschuß des Bundestags. Die Medien lassen sich das ebenso brav gefallen wie die Abgeordneten.
Im Krieg gegen den Irak beschränkten sie sich im wesentlichen auf den "embedded journalism", wie ihn das Militär geplant hatte. Der
Journalismus ließ sich - mit wenigen Ausnahmen - ausgerechnet im Krieg zu Bett bringen und einschläfern. Läßt sich Schlimmeres über die
Medien sagen?
Die Journalisten des Springer-Konzerns wurden unmittelbar nach dem 11.9.2001 arbeitsvertraglich auf "Unterstützung des transatlantischen
Bündnisses und die Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten" verpflichtet. Ungeschrieben scheint in
anderen Presseunternehmen die gleiche Pflicht zu voreingenom- menem, einseitigem, parteiischem Journalismus zu gelten. Und wenn -
vorbestimmt durch die in der Gesellschaft vorherrschenden Interessen - von vornherein feststeht, was wichtig und was unwichtig, was wahr oder
unwahr, gut oder böse ist, dann erübrigt sich eben die Recherche. Vor allem in privaten Medien findet sie kaum statt. Je größer und mächtiger
die Konzerne werden, desto stärker sparen sie daran.
Die Verlage, die als Privatunternehmen möglichst hohe Rendite abwerfen sollen, drosseln die Kosten, auch und gerade die notwendigen Kosten
journalistischer Arbeit. Die verkleinerten Redaktionen - mit verringerten Etats für freie Mitarbeiter - sind kaum noch in der Lage, mehr zu
leisten, als journalistische Fertigware weiterzutransportieren, Fertigware, geliefert von Nachrichtenagenturen oder direkt von Pressestellen und
Propagandastäben. Angeblich fehlt es an Geld. Tatsächlich sind die Einnahmen der Medien aus der Werbung in jüngster Zeit infolge der
Kaufkraftverluste großer Bevölkerungsschichten, also infolge der von den Medien selbst propagierten Sozialabbau- und
Arbeitsverbilligungspolitik, aber auch infolge vermehrter Werbung im Internet zurückgegangen; das Aufkommen an Stellen- sowie an Immobilien-
und Autoanzeigen hat deutlich abgenommen. Andererseits geht es den Medienkonzernen so gut, daß sie international expandieren. Nachdem
sie sich die ostdeutschen Medien angeeignet hatten (für sie eine Goldgrube), erwarben sie mehr und mehr Zeitungen in Polen, Tschechien und
Ungarn - mit der Konsequenz, daß die Bevölkerung dort kaum noch Medien für die Debatte über oder gar für den Protest gegen den Beitritt zur
NATO und andere umwälzende Entscheidungen hatte. Nachdem im Ergebnis der NATO-Aggression gegen Jugoslawien der frühere
Kanzleramtsminister Bodo Hombach als politischer Entwicklungshelfer nach Jugoslawien entsandt worden war, konnte es kaum verwundern,
daß sich der Essener WAZ-Konzern, Monopolist im Ruhrgebiet, die tonangebende Belgrader Zeitung aneignen konnte; Hombach ist inzwischen
Chef dieses Konzerns, der auch in Rumänien und Bulgarien die publizistische Macht übernommen hat. Die Ostexpansion - an der sich
selbstverständlich auch der Springer-Konzern beteiligt - geht weiter; die Souveränität der betroffenen Völker wird zuschanden gemacht.
Gegenmacht?
Welche Mittel gegen den Mißbrauch publizistischer Macht haben die Leserinnen und Leser einer Monopolzeitung? Sie können dort anrufen, um
sich zu beschweren, wie auch bei einer Rundfunkanstalt; möglicherweise werden sie dann aber in einem Call-Center abgewimmelt. Sie können
Leserbriefe schreiben. Sie können auch, wenn ihnen das finanziell möglich ist, versuchen, Anzeigen aufzugeben, um auf diesem Wege
unterbliebene Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen.
Die Erfahrungen, die ich hierzu vermitteln kann, sind freilich nicht sehr ermutigend. Ich beginne mit einem Beispiel aus der Zeit, als in Südafrika
noch das Apartheidregime bestand. Nach Protesten gegen eine von Unwahrheiten strotzende Anzeige zugunsten dieses damals ins Wanken
geratenden Regimes behauptete Die Welt in einem Antwortbrief: "Jede Zeitung wird jede Anzeige bringen, solange sie nicht gegen Gesetze
verstößt, d. h. zum Verstoß gegen bestehende Gesetze auffordert. Sie identifiziert sich absolut nicht mit Anzeigen und deren Inhalt, zumal es
sich bei Anzeigen nicht um einen redaktionellen Teil handelt."
Die Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung weigerte sich, einen Leserbrief gegen diese auch von ihr veröffentlichte Anzeige abzudrucken, und
begründete ihre Entscheidung so: "Die Trennung des redaktionellen vom Anzeigenteil (gehört) zu den Prinzipien aller bedeutenden Zeitungen in
den westlichen Demokratien."
Als die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände eine Anzeige mit der Parole "Streik ist Angriff. Aussperrung ist Abwehr"
schaltete, protestierten in München Setzer und Drucker gegen diesen Angriff auf ihr Streikrecht. Die Süddeutsche Zeitung empörte sich über
diese Proteste als "Zeichen der Intoleranz". Denn: "Die Freiheit geht zuschanden, wenn man gegnerische Meinungsäußerungen nicht mehr
dulden will." Und Die Welt versicherte bei ähnlicher Gelegenheit, daß "jeder, der seinen Standpunkt in einer Tageszeitung nicht genug
berücksichtigt glaubt, wenigstens dort eine Anzeige aufgeben (kann) - auch als Gewerkschaft gegen die Arbeitgeber."
Doch als z. B. einmal Schriftsteller und Wissenschaftler, darunter international bekannte wie Noam Chomsky, per Zeitungsanzeige die
Abschaffung des Gotteslästerungsparagraphen im Strafgesetzbuch forderten, den schon Kurt Tucholsky einen "mittelalterlichen
Diktaturparagraphen" genannt hatte, verweigerte die Süddeutsche Zeitung den Abdruck.
Der hannoversche Verlagskonzern Madsack, der in der zentralen Region Niedersachsens das Pressemonopol erobert hat und außerdem
inzwischen an Hörfunk- und Fernsehsendern beteiligt ist, lehnte es ab, eine Anzeige von 150 prominenten niedersächsischen Bürgern, darunter
zwei ehemaligen Ministerpräsidenten, gegen private, von Verlegern betriebene Rundfunkanstalten zu veröffentlichen. Rundfunk, so hieß es in
der verhinderten Anzeige, müsse "Forum auch für Minderheiten und alle bleiben, denen nicht die Zeitungen gehören. Überließe man den
Rundfunk den wirtschaftlich Mächtigen, dann müßte um des Grundrechts der Informationschancen willen die Presse öffentlich-rechtlich
organisiert werden." Die Verlagsleitung teilte den Initiatoren mit, eine Veröffentlichung der Anzeige komme nur in Frage, wenn diese Aussagen
gestrichen oder verändert würden.
Als die neonazistische Partei DVU für die Bremer Bürgerschaft kandidierte, durfte eine Hausfrau inserieren: "Ich möchte wissen, woher die
alten Nazis soviel Geld haben..." Abgelehnt wurde die Anzeige eines ehemaligen KZ-Häftlings: "Wo die alten Nazis ihr Geld herhatten, weiß
ich. Sie wurden vom Kapital bezahlt." Der Bremer Monopolverlag ließ kühl wissen, die Verlagsleitung sei mit der Aussage nicht einverstanden.
Inzwischen hatte das Landgericht Stuttgart den beiden Stuttgarter Tageszeitungen das Recht zugesprochen, ein Inserat des Deutschen
Gewerkschaftsbundes abzulehnen. Die Pressefreiheit erstrecke sich nicht nur auf den redaktionellen, sondern auch auf den Anzeigenteil,
urteilte das Gericht und stützte sich auf eine schon 1976 ergangene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Presse "den
Abdruck von Anzeigen und Leserzuschriften einer bestimmten Richtung verweigern" dürfe, ohne daß dadurch die Rechte des Inserenten
unzulässig beeinträchtigt würden. Daran ändere auch eine regionale Monopolstellung nichts. Entscheidend für den Abdruck von Anzeigen
politischen Inhalts sei allein das Ermessen des Verlages.
Individualrecht der Unternehmer
So wird die Pressefreiheit in der Bundesrepublik Deutschland als Individualrecht einiger weniger Unternehmer interpretiert statt, wie im
Grundgesetz vorgesehen, als Grundrecht aller Bürgerinnen und Bürger. Und die Verlage machen eifrig von diesem ins Gegenteil verkehrten
Recht Gebrauch. Der schon erwähnte WAZ-Konzern in Essen verweigerte zum Beispiel der IG Metall eine Anzeige gegen die Einschränkung
des Streikrechts durch das Arbeitsförderungsgesetz. Der Springer-Konzern zensierte eine Anzeige derselben Gewerkschaft: Auf Anweisung der
Verlagsleitung des Springer-Blattes Elmshorner Nachrichten mußte sie bei der Veröffentlichung ihres "Elmshorner Manifests zur Verteidigung
des Grundrechtes auf Streik" die Namen derjenigen Erstunterzeichner entfernen, die als DKP- oder PDS-Mitglieder zu erkennen waren. Die
Frankfurter Rundschau lehnte eine Anzeige der "Achse des Friedens" anläßlich eines Besuchs des US-Präsidenten George W. Bush in
Deutschland ab, in der es hieß: "Wir wollen Ihre Kriege nicht, Herr Präsident! ... Wir wollen überhaupt keinen Krieg." Die Verlagsleitung teilte
lediglich mit: "Aus verlegerischer Sicht möchten wir von einer Veröffentlichung in der Frankfurter Rundschau absehen." Zur gleichen Zeit
erschien in der FR eine Extra-Seite mit der Überschrift "Welcome, Mr. President". Als die an der "Achse des Friedens" beteiligte Organisation
ATTAC per Anzeige gegen diesen Eingriff in das Grundrecht der Meinungsfreiheit protestieren wollte, lehnte die FR wiederum aus
"verlegerischen Gründen" ab.
Ähnlich sind meine Erfahrungen mit dem Mittel der Gegendarstellung: Einer Zeitung, die etwas Falsches über mich behauptet hatte, schickte
ich unter Berufung auf das Pressegesetz eine Gegendarstellung. Sie weigerte sich, sie zu drucken. Ich bemühte ein Gericht, das mir recht gab.
Der Zeitungsverlag legte Berufung ein. In zweiter Instanz bekam ich wiederum recht. Die Gegendarstellung, von Juristen aufs knappste
reduziert, erschien einige Monate nach dem Artikel, der längst seine Wirkung getan hatte, und wirkte jetzt eher befremdlich, aus sich heraus
kaum verständlich; und ich wurde spöttisch darauf angesprochen, daß ich offenbar sehr viel Zeit gebraucht hätte, die paar Zeilen zu formulieren.
Und auch den Deutschen Presserat, dem ich einige Jahre angehört habe, sehe ich ähnlich. Seine Gründung geht auf die Weigerung der
Verleger zurück, sich journalistischer Mitbestimmung oder öffentlicher Kontrolle zu unterwerfen. Bestenfalls rügt der Presserat gelegentlich
einzelne Veröffentlichungen - jeweils lange nach ihrem Erscheinen. Die unzähligen Kriegslügen, die die Medien füllen, bleiben ungerügt. Die
vielen Lügen zur Rechtfertigung des Sozialabbaus desgleichen.
Grundrechte geltend machen
Mit diesen Erfahrungen will ich keinesfalls entmutigen. Im Gegenteil, denn Einschüchterung demokratischen Engagements ist ja gerade die
Hauptleistung der Springer- und ähnlicher Medien. Wir müssen unsere Grundrechte, wenn sie nicht nur auf dem Papier stehen sollen, öffentlich
geltend machen, auch und gerade das Grundrecht der Informations- und Meinungsfreiheit - aber in dem Bewußtsein, daß es sehr schwer ist,
die entstandenen publizistischen Machtstrukturen aufzubrechen. Als vorrangig sehe ich die Aufgabe an, den permanenten Mißbrauch
publizistischer Macht zu dokumentieren, damit die notwendige politische Auseinandersetzung geführt werden kann. Verantwortliche
Journalisten, aber auch die Verleger selbst müssen immer wieder ins öffentliche Gespräch gezogen werden. Davon dürfen wir uns nicht durch
die demagogische Parole abschrecken lassen, unsere Kritik an den Medien richte sich gegen die Pressefreiheit - während sie sich doch in
Wahrheit gegen die Usurpation der Pressefreiheit durch die wirtschaftlich Mächtigen richtet. Kritik der auf wahrheitsgemäße Berichterstattung
angewiesenen Mediennutzer an unwahrer Berichterstattung ist durchaus im Interesse kritischer, verantwortungsbewußter Journalisten und kann
ihnen helfen, wenn sie selbst sich um Arbeitsbedingungen bemühen, die sie brauchen, um ihren Beruf so ausüben zu können, wie es sich in
einer demokratischen Gesellschaft gehören würde.
Eckart Spoo
Anmerkung:
Eckart Spoo ist Herausgeber und Redakteur der Zeitschrift 'Ossietzky'. Bei dem obigen Text handelt es sich um größere Teile einer Analyse, die im Jahrbuch 2004 ("Medien, Bürgerrechte und Politik") des Komitees für Grundrechte und Demokratie erscheint.
Wir danken für die Erlaubnis zur Nachveröffentlichung.