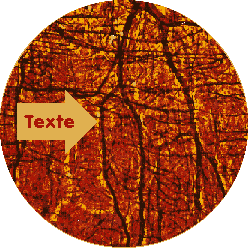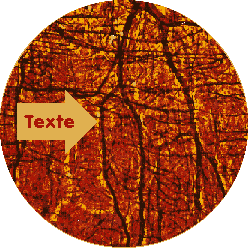Kommentar von Friedrich Wolff in der 'jungen Welt' vom
24. August 2004
Damit der Sozialabbau ungestört von sozialen
Erinnerungen stattfinden kann. Rechtsstaat contra
Unrechtsstaat. Gedanken nach dem letzten Politbüroprozeß
Am 6. August 2004 wurde das Urteil im sogenannten 2.
Politbüroprozeß verkündet. Es war das letzte Urteil gegen
Mitglieder des Politbüros des ZK der SED nach den Prozessen
gegen Erich Honecker und Egon Krenz. Es gilt als Abschluß der
juristischen »Bewältigung« der DDR-Vergangenheit. Vor fast
13 Jahren hatte der frühere Gegenspieler von Erich Mielke, der
damalige Justiz- und spätere Außenminister, Klaus Kinkel, mit
einer historischen Rede die Kampagne eröffnet. In seiner
Begrüßungsansprache auf dem Deutschen Richtertag am 23.
September 1991 in Köln hatte er erklärt: »Ich baue auf die
deutsche Justiz. Es muß gelingen, das SED-System zu
delegitimieren, das bis zum bitteren Ende seine Rechtfertigung
aus antifaschistischer Gesinnung, angeblich höheren Werten
und behaupteter absoluter Humanität hergeleitet hat,
während es unter dem Deckmantel des Marxismus-Leninismus
einen Staat aufbaute, der in weiten Bereichen genauso
unmenschlich und schrecklich war wie das faschistische
Deutschland, das man bekämpfte und - zu Recht - nie mehr
wieder erstehen lassen wollte.«1 Das Landgericht Berlin
fällte sechs Monate später das erste Mauerschützenurteil. Es
erfüllte Kinkels Erwartungen.
100.000 Ermittlungsverfahren
Der letzte Prozeß gegen Politbüromitglieder warf noch einmal
ein Schlaglicht auf die Welle der Verfolgung von Kommunisten
und Sozialisten, die nach dem 3. Oktober 1990 eingesetzt
hatte. Der den Vorsitz führende Richter Thomas Groß hielt es
gleich zu Beginn der Urteilsverkündung für erforderlich zu
erklären, dies sei kein politischer, sondern ein ganz normaler
Prozeß gewesen. Hätte er das Standardwerk »Politische
Justiz« von Otto Kirchheimer gelesen, hätte er das nicht
gesagt. Dieser schrieb nämlich 1961 in den USA: »Daran, daß
jemand zwischen politischen und anderen Delikten keinen
Unterschied sieht, kann man mit Sicherheit erkennen, daß er
ein Hitzkopf oder ein Dummkopf ist«.
Unpolitisch soll es sein, wenn die höchsten Spitzen eines
sozialistischen Staates vor dem Gericht eines kapitalistischen
Staates stehen? Unpolitisch soll es sein, daß ein BRD-Gericht
entscheidet, wie sich DDR-Politiker im Kalten Krieg hätten
verhalten müssen? Unparteiisch und fair im Sinne der
Europäischen Menschenrechtskonvention soll ein solches
Verfahren sein? Normal soll es sein, daß ein Strafprozeß zehn
Jahre dauert, obgleich Tat und Opfer immer bekannt und alle
Politbüromitglieder seit 1990 verdächtigt worden waren?
Warum so lange, wenn alles klar und rechtens ist?
Über 100.000 strafrechtliche Ermittlungsverfahren sollten die
Delegitimierung der DDR bewirken. Polizisten, Staatsanwälte,
Richter und technisches Personal standen genügend zur
Verfügung, auch an Geld fehlte es nicht. Zehn Jahre und länger
hielten die Bemühungen der Justiz an. Schwerpunkte waren
erst die Schüsse an der Grenze, dann Rechtsbeugungen durch
DDR-Juristen und zuletzt Doping. Ebensolange berichteten die
Medien von Anklagen, Eröffnungsbeschlüssen,
Hauptverhandlungen, Plädoyers, Urteilen und immer wieder
von den Untaten der Stasi, von Folter, Morden,
Röntgenbestrahlung von Häftlingen, Tötung von Kindern nach
der Geburt, Zwangsadoptionen, medizinischen Versuchen an
Patienten, Einweisungen in die Psychiatrie, vom Lotterleben
der Bonzen usw. Viele glaubten der freien, der unabhängigen
Presse, auch Juristen.
289 Verurteilungen
Die Ergebnisse der über 100.000 staatsanwaltlichen
Ermittlungsverfahren wurden den Horrormeldungen nicht
gerecht. Christoph Schaefgen, der maßgebliche Staatsanwalt
auf diesem Gebiet, sagte, sie seien »hinter den Erwartungen
zurückgeblieben«. Niemand gab zu, daß die Erwartungen
falsch waren, niemand zog eine Bilanz dessen, was man
Vergangenheitsbewältigung nannte. Kein Bundestag, keine
Enquetekommission, kein Landtag, keine Justizstatistik
berichtete von dem Resultat der Aufgabe, die Kinkel am 9. Juli
1991 so hoch gehängt hatte, als er ausrief: »Die Aufgabe, die
vor uns steht, ist gewaltig. Nicht nur der Rechtsstaat, unsere
ganze Gesellschaft muß sich der Bewältigung des
DDR-Unrechts stellen.«
Was die Bewältigung des DDR-Unrechts ergeben hatte, erfuhr
»unsere ganze Gesellschaft« mitnichten. Lediglich
Generalstaatsanwalt Christoph Schaefgen publizierte für einen
kleinen Kreis interessierter Juristen in der Zeitschrift Neue
Justiz im Heft 1 des Jahres 2000 eine vergeblich um
Verschleierung bemühte Bilanz unter dem Titel: »Zehn Jahre
Aufarbeitung des Staatsunrechts in der DDR«. Er stellte
zunächst fest: »Nach dem Stand von Anfang 1999 sind etwa
62.000 Ermittlungsverfahren bundesweit gegen ungefähr
100.000 Beschuldigte eingeleitet worden. Davon wurden bisher
nur etwa 300 Personen rechtskräftig verurteilt.« Die Verfahren
wegen der Auslandsspionage der DDR, die später vom
Bundesverfassungsgericht beendet wurden, sind nicht dabei.
Sie sollen weitere 6.000 Beschuldigte betroffen haben.
Zwei Rechtsprofessoren der Humboldt-Universität, Klaus
Marxen und Gerhard Werle, stellten fest, 100.000 Personen
wurden beschuldigt, 1.212 wurden angeklagt, und von ihnen
wurden 289 verurteilt. Ein solches Mißverhältnis zwischen der
Zahl der Beschuldigten, der Angeklagten und der Verurteilten
gab es schon einmal und zwar bei der Verfolgung von
Kommunisten in der BRD in den Jahren 1949 bis 1968. Dazu
schrieb der Spiegel 1966 treffend: »Zwanzigmal verdächtigen
oder beschuldigen sie Unschuldige, ehe sie einen
Kommunisten fangen, der dann auch verurteilt wird.« Etwa
dreißig Jahre später dasselbe Bild. Nur muß es jetzt heißen:
Dreihundertzweiunddreißigmal beschuldigen sie Unschuldige,
ehe sie einen ehemaligen DDR-Bürger fangen, der dann auch
verurteilt wird. Die Parallelität ist kein Zufall, es geht gegen
denselben politischen Gegner.
Die Art des »Staatsunrechts« der DDR wird deutlich, wenn man
die Daten von Marxen/Werle2 und Schaefgen3 tabellarisch
zusammenstellt:
|
Tätergruppen
|
Zahl der
Angeklagten
nach Marxen
|
Zahl der
Verurteilten
nach Marxen
|
Zahl der
Angeklagten
nach Schaefgen
|
Zahl der
Verurteilten
nach Schaefgen
|
Gewalttaten an
der Grenze
|
363
|
98
|
242
|
106
|
|
Rechtsbeugung
|
400
|
27
|
223
|
27
|
|
Wahlfälschung
|
127
|
92
|
k. A.*
|
k. A.
|
|
MfS-Straftaten
|
143
|
20
|
99
|
25
|
|
Denunziationen
|
15
|
4
|
k. A.
|
k. A.
|
|
Mißhandlungen
|
53
|
19
|
k. A.
|
k. A.
|
Amtsmißbrauch/
Korruption
|
56
|
22
|
k. A.
|
k. A.
|
Wirtschafts-
straftaten
|
42
|
5
|
k. A.
|
k. A.
|
|
Doping
|
6
|
2
|
k. A.
|
k. A.
|
|
Sonstige
|
7
|
2
|
k. A.
|
k. A.
|
|
Insgesamt
|
1212
|
289
|
k. A.
|
300
|
|
* k. A. = keine Angaben
|
Die Zahl der Verurteilten sagt nichts über die Rechtmäßigkeit
der Urteile. Zweifel in dieser Hinsicht haben die Medien nicht,
wir leben schließlich im Rechtsstaat. Die Rechtswissenschaftler
hatten sich allerdings ganz überwiegend und sehr deutlich
gegen die Verurteilungen gewandt, wenn man von den
Wahlfälschungen absieht.
Rückwirkungsverbot aufgehoben
Der Präsident des Bundesgerichtshofs (BGH), Walter Odersky,
sagte 1991: »Selbstverständlich gilt auch bei der Aufarbeitung
des SED-Unrechts durch unsere Strafverfolgungsorgane und
Gerichte der Grundsatz ›nulla poena sine lege‹, das heißt, eine
Tat kann nur bestraft werden, wenn sie zur Zeit, als sie
geschah, für den Täter, der sie verübte, strafbar war. Das ist
ein Kernsatz unseres rechtsstaatlichen Verständnisses und Sie
werden - diese Behauptung wage ich - keinen Richter finden,
der etwas anderes zu tun bereit wäre.«4 Hier irrte Odersky,
nicht nur die Richter des BGH und des
Bundesverfassungsgerichts hielten nichts von dem
»Kernsatz«, sondern meinten das Rückwirkungsverbot müsse
hier »zurücktreten«.5 Der Europäische Gerichtshof folgte
ihnen, allerdings mit anderer Begründung. 98 Soldaten und
Offiziere der NVA sowie die Politbüromitglieder wären nicht
verurteilt worden, wenn Odersky recht behalten hätte.
Nach den Grenzdelikten und den Wahlfälschungen bildeten die
Rechtsbeugungsfälle die drittstärkste Gruppe von
Verurteilungen. Hierzu sagte Frau Limbach 1992: »Schon nach
der völkerrechtlichen und innerstaatlichen Rechtslage dürfte es
gleichwohl schwerfallen, eine Rechtsbeugung darzulegen; es
sei denn, es handelte sich bei dem Antrag oder Urteil um eine
außergewöhnliche Sanktion.«6 27 Verurteilungen wären hier
entfallen, wenn Frau Limbach recht behalten und die Richter
wie die Professoren geurteilt hätten.
Alle Verurteilungen fielen milde aus, also keine »Siegerjustiz«,
sagt man. Doch Kirchheimer meint: »Vielerlei läßt sich in
politischen Konflikten mit einem Kriminalprozeß anfangen.« Und
er nennt als Beispiel: »Machthaber vom totalitären Schlage, die
gerade an die Macht gekommen sind, können selten der
Versuchung widerstehen, mit der alten Ordnung liierte
Gruppen, die kaum je den Gefahren politischer Strafverfolgung
ausgesetzt waren, auf besondere Art in Mißkredit zu bringen
...«. In Mißkredit mußte die DDR gebracht werden, damit der
Sozialabbau ungestört von Erinnerungen an den Sozialismus
stattfinden kann.
Alles in allem zeigt die Bilanz der Vergangenheitsbewältigung,
die Strafverfahren haben trotz des großen Aufwands die These
vom Unrechtsstaat nicht nur nicht bestätigt, sondern
widerlegt. Dennoch wurde das Ziel der Diskriminierung des
politischen Gegners, d. h. des realen Sozialismus, wohl
weitgehend erreicht. Die Medienkampagne im Zusammenhang
mit den jahrelang schwebenden Verfahren, das Verschweigen
ihrer Ergebnisse erzeugten in der öffentlichen Meinung das
gewünschte Bild. Es wird, ungeachtet des Resultats der
Strafverfolgung, weiter verbreitet. So schreibt noch im Jahr
2001 ein Thomas Kunze in seinem Buch »Staatschef a. D. Die
letzten Jahre des Erich Honecker« von der »Stasi«, daß sie es
... »in ihren Gefängnissen für opportun betrachtete, Häftlinge
in Eis- und Wasserzellen zu sperren, ihnen Psychopharmaka
zu verabreichen, sie mit Elektroschocks zu foltern, sie zu
schlagen und zu demütigen ...«.7 Keine einzige Verurteilung
wegen solcher Untaten können Schaefgen, Marxen und Werle
nennen, keine Anklage, nicht einmal ein Ermittlungsverfahren.
Doch die Lügen werden weiter geglaubt, und das reicht.
Sonderrecht
Die strafrechtliche Verfolgung der wirklichen oder
vermeintlichen politischen Gegner aus der DDR ist jedoch nur
eine Seite der politischen Justiz gegen ehemalige DDR-Bürger.
Auf fast allen anderen Rechtsgebieten delegitimierten die
Gerichte gleichfalls. Im Verwaltungs- und Zivilrecht wurden
ehemalige DDR-Bürger von ihren Grundstücken vertrieben, im
Sozialrecht wurden die »Staatsnahen« mit Rentenkürzung
bestraft. Besonders brutal fand das bei den MfS-Angehörigen
statt. Den 25 gerichtlich festgestellten Straftaten von
MfS-Angestellten stehen einschneidende Kürzungen bei
100000 Rentnern gegenüber.8 »Wir werden sie nicht in
Lager sperren, das haben wir nicht nötig. Wir werden sie an
den sozialen Rand drängen«, hatte ein CDU-Vertreter 1991 in
Wildbad Kreuth verkündet. Alles rechtsstaatlich, alles christlich.
Überdeutlich werden die politischen Intentionen und
Haltungen, wenn man vergleicht, wie ehemalige Nazis
rentenrechtlich behandelt wurden. Prof. Detlef Merten hat
dazu festgestellt, daß von Sonderbestimmungen des
Rentenrechts ein wesentlich kleinerer Personenkreis
ehemaliger faschistischer Beamter als ehemaliger
DDR-Funktionäre betroffen war. Die Nachteile für die Nazis
waren überdies wesentlich weniger einschneidend als die für
ehemalige DDR-Angestellte. Seit Friedrich Wilhelm IV., der
heute der »Romantiker auf dem Thron« genannt wird, 1848 mit
Kanonen auf seine »lieben Berliner« schießen ließ, wendet sich
deutsche Justiz gegen Sozialisten und Kommunisten. Nur in
der DDR war das einmal anders, und das gilt heute als
Rechtsbeugung. Oberstaatsanwalt Bernhard Jahntz sprach
mangels eines realen Schießbefehls vom »ideologischen
Schießbefehl«, die Justiz hat ideologisch zurückgeschossen.
Friedrich Wolff
Anmerkungen:
1 Deutsche Richterzeitung 1992, S. 4/5
2 Klaus Marxen/Gerhard Werle: Die strafrechtliche
Aufarbeitung von DDR-Unrecht. Eine Bilanz. Berlin, New York
1999, S. 202
3 Christoph Schaefgen: 10 Jahre Aufarbeitung des
Staatsunrechts in der DDR, Neue Justiz 2000, S. 1 ff.
4 Walter Odersky: in 40 Jahre SED-Unrecht. Eine
Herausforderung für den Rechtsstaat, Sonderheft der
Zeitschrift für Gesetzgebung, S. 34
5 Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 24.10.1996, Bd.95, S.
133
6 Jutta Limbach: Strafrechtliche Verantwortlichkeit für die
Ausübung politischer Strafjustiz in der ehemaligen DDR. In
Lampe (Hg.): Die Verfolgung von Regierungskriminalität nach
der Wiedervereinigung, Köln, 1993, S. 105
7 Thomas Kunze: Staatschef a.D. Die letzten Jahre des Erich
Honecker«, Berlin 2001, S. 72
8 Detlef Merten: Verfassungsprobleme der
Versorgungsüberleitung, Berlin, 1993, S. 103 f.
Zurück zum Anti-Kommentar von K. Schramm
|