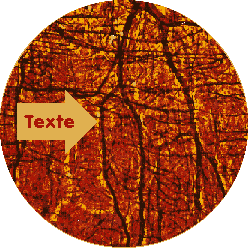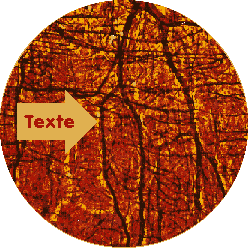Bundesverfassungsgericht entscheidet über "Luftsicherheitsgesetz"
Jeder Staat - und damit der Kreis der Menschen, die über Macht verfügen - maßt sich tendentiell das Recht an, über Leben oder Tod "seiner" Staatsbürger zu entscheiden. Das beginnt bei dem "Ausnahmefall" Krieg, in dem eine Lizenz zum Töten vergeben, also Mord gerechtfertigt wird, und das endet nicht bei der bewußt in Kauf genommenen Tötungspotenz der Polizei, soweit diese mit Schußwaffen ausgestattet wird. Mit der Legitimation eines "Gewaltmonopols", das dem Staat zugestanden wird, begibt sich die Zivilisation auf eine schiefe Ebene, auf der es auf die Dauer kein Halten gibt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte selbst ein Franz Josef Strauß geschworen, ihm solle eher die Hand abfaulen, als daß er je wieder eine Waffe in die Hand nähme. Nur wenige Jahre später wurde gegen heftigen Widerstand, an dem sich auch der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann beteiligte, die Bundeswehr aufgebaut. 1954 und 1956 wurde das Grundgesetz entsprechend geändert und nachdem die westlichen Siegermächte 1955 die Erlaubnis gegeben hatten, wurde die BRD zu einem "richtigen Staat". 1989 offenbarte ausgerechnet Franz Josef Strauß in seinen Memoiren, daß bereits 1958 der deutsche, der französische und der britische Außenminister bei einem Geheimtreffen ein Abkommen zur geheimen Produktion von Atomwaffen unterzeichnet hatten.
1973 passierte die Bundesrepublik Deutschland einen weiteren Punkt der schiefen Ebene: Mit dem Konzept des "finalen Rettungsschusses" wurde das Grundrecht auf Leben weiter eingeschränkt. Eine angebliche Abwägung zwischen dem Leben eines potentiellen oder vermuteten Gewalttäters und dem Leben vermutlich bedrohter Personen rechtfertigt nach diesem Konzept die gezielte Tötung eines Menschen ohne Beweisaufnahme, richterliches Urteil oder Möglichkeit der Revision. In den Jahren nach 1973 wurde der "finale Rettungsschuß" in die Polizeigesetze von 12 von 16 Bundesländern aufgenommen. Bekannt wurde beispielsweise der Fall einer Geiselnahme 1999 in Aachen. Nach über 50 Stunden Verhandlungen tötete ein Scharfschütze der Polizei den Geiselnehmer mit einem Kopfschuß.
Zu einer Art Hinrichtung kam es vermutlich am 27. Juni 1993 auf dem Bahnhofsgelände von Bad Kleinen. In diesem Fall wurde im Nachhinein zwar von staatlicher Seite alles getan, um den Tod eines Terroristen als Selbstmord darzustellen. Die Fakten widersprechen jedoch in vielerlei Hinsicht der offiziellen Version. Als die GSG 9 den Terroristen Wolfgang Grams, der von einer weiteren Terroristin und einem Polizeispitzel begleitet wird, zu verhaften versucht, kommt es zu einer Schießerei. Dabei wird der GSG 9-Beamte Michael Newrzella unter zunächst ungeklärten Umständen - vermutlich von Wolfgang Grams - tödlich getroffen. Kurz darauf kommt Grams auf den Geleisen zu Tode.
Nach der einen Version befand sich seine Schußwaffe bereits außerhalb seiner Reichweite auf dem Bahnsteig, nach der offiziellen - später verbreiteten Version - tötete er sich mit seiner Waffe selbst. Laut ursprünglicher Aussage aller beteiligter GSG-9-BeamtInnen hatte keiner von ihnen den Selbstmord Grams' gesehen. Noch am Tag nach dem Schußwechsel hatten es die Behörden nicht für nötig befunden, den Tathergang anhand der Spuren - wie sonst üblich - zu rekonstruieren. Geschoßhülsen wurden von JournalistInnen aufgesammelt. Am 1. Juli 1993 veröffentlichte die TV-Sendung 'Monitor' die eidesstattliche Aussage einer Zeugin, der Kioskverkäuferin am Ort des Geschehens: Einer der GSG-9-Beamten schoß Wolfgang Grams, der reglos auf dem Gleis gelegen habe, aus nächster Nähe gezielt in den Kopf. Ein anderer GSG-9-Beamter habe mehrmals auf Bauch oder Beine geschossen. Der damalige Bundesinnenminister Rudolf Seiters übernahm umgehend die "politische Verantwortung" für den Skandal und trat zurück. Doch die darauf folgenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Schwerin erbrachten später "keinerlei Anhaltspunkte" für einen Skandal und kamen zum Ergebnis, Grams habe sich selbst getötet.
Am heutigen Mittwoch nun geht es in Karlsruhe um die Lizenz zum Abschuß von Passagierflugzeugen.1 Das Bundesverfassungsgericht hat das im September 2004 von der "rot-grünen" Bundesregierung beschlossene Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) darauf zu prüfen, ob es mit der Verfassung übereinstimmt. Wie der vorangegangenen öffentlichen Diskussion zu entnehmen ist, argumentierte die Bundesregierung mit der Möglichkeit eines Anschlags mit entführten Passagierflugzeugen nach dem Vorbild des 11. September 2001. Weniger in die Öffentlichkeit gelangte das erweiterte Horroszenario, das sich ergibt, wenn der mangelnde Schutz der deutschen Atomkraftwerke gegen einen gezielten Flugzeugabsturz in Betracht gezogen wird.2
Selbst der sonst so forsche neue Bundespräsident Horst Köhler hatte gezögert, das LuftSiG zu unterzeichnen. Es sickerte durch, daß seine BeraterInnen große verfassungsrechtliche Bedenken geltend machten und so ein schwerwiegender Image-Verlust droht, wenn das Gesetz keinen Bestand vor dem Bundesverfassungsgericht haben sollte. Doch Köhler ließ das Gesetz passieren, indem er seine Unterschrift darunter setzte.
Vier RechtsanwältInnen und ein Flugkapitän, darunter der ehemalige Vizepräsident des Bundestags, Burkhard Hirsch, reichten in Karlsruhe Verfassungsklage ein. Diese wird nun beginnend mit dem heutigen Tag verhandelt. Der noch amtierende Bundesinnenminister Otto Schily sorgte für öffentliche Verwirrung: Ein Abschuß von Passagierflugzeugen sei auch mit dem neuen Gesetz gar nicht zulässig.
Doch dies beurteilte bereits 1972 der damalige Bundesverteidigungs- minister Georg Leber ganz anders. Leber sah die Rechtsgrundlage zum Abschuß einer Passagiermaschine auch ohne das LuftSiG von 2004 als gegeben. Am 11. September 1972, dem Tag der Abschlußfeier der Olympischen Spiele in München, ließ Georg Leber zwei Jagdmaschinen aufsteigen, um ein "offensichtlich" von arabischen Terroristen entführtes Flugzeug, eine DC 8, das sich im Anflug auf das Olympiastadion befand, abzuschießen. Leber schrieb später: "Wäre die DC 8 nicht abgedreht, hätte ich zwei Minuten später den Piloten der Luftwaffe den Feuerbefehl erteilen müssen." Rechtzeitig jedoch traf zum Glück die Information ein, daß es sich um ein finnisches Passagierflugzeug handelte, dessen Radar defekt war.
Aktuell wurde das seit 1972 in informierten Kreisen nicht vergessene Gefahrenszenario einmal wieder im Januar 2003, als ein Motorsegler zwischen den Bank-Hochhäusern von Frankfurt am Main gesichtet wurde. Darüber hinweg donnerten hilflos die modernen Jagdmaschinen der Bundeswehr. Life im TV erinnerte das Bild an die terroristischen Anschläge vom 11. September 2001, an die einstürzenden Türme des World Trade Centers. Es wurde spekuliert, ob der Motorsegler Sprengstoff, Chemikalien oder biologische Kampfstoffe geladen habe. Die Piloten der Bundeswehr-Tornados hätten auch im Januar 2003 - ein halbes Jahr vor dem Beschluß des LuftSiG - den Motorsegler abgeschossen, wenn Minister Struck den Befehl erteilt hätte. Dann "wäre ich anschließend zurückgetreten", erklärte Struck, nachdem der Pilot des Motorseglers, ein psychisch Kranker, über Funk zur Landung hatte überredet werden können.
Ein Waffensystemoffizier der Bundeswehr, der im Zweifelsfall einen solchen Befehl ausführen müßte, antwortete auf eine entsprechende Frage: "Ich kann nach einem Abschuß nicht zurücktreten." Auch in der Bundeswehr gibt es KritikerInnen des LuftSiG, die sich aber in Anbetracht der freiheitlichen Zustände und als "Bürger in Uniform" lieber nicht zu erkennen geben. Aus diesen Kreisen stammen jedoch ernst zu nehmende Argumente. Obwohl berufsbedingt nicht grundsätzlich dem Mord-Job abgeneigt, weisen sie darauf hin, daß der Abschuß einer Passagiermaschine in der Regel allein aus pragmatischen Gründen nicht in Frage kommt. Beispielsweise Frankfurt: Flughafen und Siedlungsgebiet liegen derart dicht beieinander, daß ein Abschuß mehr Tote zur Folge haben kann als ein vermeintlich gezielter Absturz. "Wir werden kaum die Chance haben, rechtzeitig ins Cockpit zu schauen, um dort einen Mann mit Turban zu sehen, der wild mit der Pistole herumfuchtelt und uns gar noch per Funk sein Anschlagsziel verkündet," erklärte ein anonymer Waffensystemoffizier.
Mehrmals pro Woche - so anonyme Quellen aus der Bundeswehr - starten allein vom Fliegerhorst Wittmund an der Nordsee Abfangjäger, um Passagiermaschinen zu überprüfen, deren Funkkontakt abgebrochen ist. Ein mehrere hundert Kilometer entferntes Linienflugzeug wird zwar in wenigen Minuten erreicht. Die Abfangjäger fliegen bis auf 100 Meter an das Cockpit des verdächtigen Flugzeugs heran. Doch wenn der Flugkapitän von dort nicht freundlich herüber winkt, ist guter Rat teuer. "Wer hat das Recht, den Abschuß von Unschuldigen zu befehlen, wenn niemand sicher wissen kann, was im Inneren des verdächtigen Flugzeugs vor sich geht?", ist die entscheidende Frage, die auch von Bundeswehrangehörigen gestellt wird. Zu vage sind nach der Erfahrung der professionellen Flugzeugjäger aus der Bundeswehr in aller Regel die Informationen, als daß auf solcher Grundlage über Leben und Tod entschieden werden könnte. Wenn außerdem - wie nicht selten - schlechtes Wetter, geschlossene Wolkendecke oder Dunkelheit hinzukommen, ist eine Aufklärung vollends aussichtslos. Und Atomkraftwerke liegen im dichten Luftverkehsraum über der Bundesrepublik so nahe an den üblichen Flugrouten, daß zwischen Kaperung und gezieltem Absturz nur wenige Flugminuten liegen müssen. Zu wenig Zeit, um zwischen einem verirrten und einem gekaperten Linienflugzeug unterscheiden zu können. Als verantwortungsvolle Konsequenz bleibt allein die sofortige Stillegung aller Atomkraftwerke.
Verfassungsrechtlich spielt ein weiterer Punkt eine bedeutende Rolle bei der Beurteilung: Bislang war - auch beim "finalen Todesschuß" - die Polizei zuständig für die Gefahrenabwehr im Inneren. Für den Abschuß eines Passagierflugzeugs kommt jedoch allein die Bundeswehr in Frage. Mit dem LuftSiG wurde die aus guten Gründen gezogene Grenze zwischen Polizei und Militär einmal mehr durchlöchert. Sollte das Bundesverfassungsgericht die Lizenz zum Abschuß von Passagierflugzeugen absegnen, würde damit dem Bestreben der Politik, den Einsatz der Bundeswehr im Inneren mehr und mehr zu enttabuisieren, Vorschub geleistet.
Die Beschwerdeführer, darunter Burghard Hirsch, argumentieren vor dem Bundesverfassungsgericht recht widersprüchlich und wenig stringent. Sie kritisieren, daß es mit dem LuftSiG dem Staat erlaubt werde, nicht mehr allein Täter, sondern auch mögliche Opfer eines Verbrechens zu töten. Sie vergessen dabei, daß auch ein Geiselnehmer kein Mörder ist, solange er keine Geisel getötet hat. Sie kritisieren das scheinbare Pro-Argument von den "praktisch bereits toten" Geiseln, indem sie allein auf mangelnde Information und zweifelhafte Wahrscheinlichkeit verweisen. Grundsätzlich ist jedoch darauf hinzuweisen, daß selbst in Staaten, in denen die Todesstrafe verhängt werden kann, die Entscheidung über Leben und Tod allein einem Gericht und nicht etwa der Entscheidungsbefugnis eines Ministers überantwortet wird.
Burkhard Hirsch meinte kürzlich in der 'Zeit': "Der Verteidigungs- minister kann nicht lieber Gott spielen. Wer maßt sich an zu entscheiden, wer sterben soll und wer nicht?" Hirsch blendet dabei Afghanistan aus. Offenbar geht es längst nicht mehr um diese grundsätzliche Frage. Vielleicht geht es letztlich nur mehr um die Frage, ob nach dem Abschuß eines Passagierflugzeugs der jeweilige Verteidigungsminister zurücktreten muß oder ob in Zukunft auch eine solche Relativierung des Grundrechts auf Leben als Normalität gesellschaftlich akzeptiert wird.
Klaus Schramm
Anmerkungen
1 Siehe auch unseren Artikel:
Präventiver Abschuß von Flugzeugen
Es geht um ungesicherte AKWs (12.01.05)
2 Siehe auch unsere Artikel:
Amt für Fragenschutz (21.06.04)
Deutsche AKWs ungesichert gegen Flugzeug-Terror (17.12.03)
AKWs ungeschützt gegen Terror-Angriffe (7.04.03)